| Volltext anzeigen | |
Grenzen des Sozialstaates Der Ausbau des Sozialstaates war in Art. 151 der Weimarer Verfassung verankert: „Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.“ Auf der Grundlage der in der Kaiserzeit eingeführten Sozialversicherungen wurden die staatlichen Leistungen erweitert. 1918 führte der Rat der Volksbeauftragten den Rechtsanspruch auf Erwerbslosenfürsorge ein. Sie löste die auf karitativen Vorstellungen beruhende Armenfürsorge ab und erhöhte die Zuwendungen. Die Beiträge für die 1927 eingeführte Arbeitslosenversicherung legten den Grundstein zu unserem heutigen System. Sie wurden paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen und durch staatliche Zuschüsse gesichert. Mit der Massenarbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise 1929 war der Staat jedoch überfordert. Da die Sozialausgaben stiegen und gleichzeitig die Steuereinnahmen sanken, wurde die Unterstützung für Arbeitslose gekürzt. Im Juni 1932 senkte die Regierung die Bezugsdauer für Leistungsempfänger, die ohnehin nur ein Existenzminimum bezogen, von 26 auf sechs Wochen. Bedürftige Arbeitslose bekamen anschließend für maximal ein Jahr die zum Teil noch geringeren Sätze der Krisenfürsorge. Sogenannte „Wohlfahrtserwerbslose“ waren schließlich auf die Unterstützung durch die Gemeinden angewiesen (u M3). 1932 erhielten nur noch 800 000 Menschen Arbeitslosenunterstützung, 1,4 Millionen waren in der Krisenfürsorge, 2,2 Millionen zählten zu den Wohlfahrtserwerbslosen und gut eine Million bekam überhaupt keine Leistungen mehr. Der Parlamentarismus auf dem Prüfstand Nach den Wahlen vom 20. Mai 1928, bei denen die Parteien der bürgerlichen Mitte zum Teil erhebliche Stimmenanteile eingebüßt hatten, bildete die SPD als stärkste Fraktion mit Zentrum, DDP, DVP und Bayerischer Volkspartei (BVP) eine Große Koalition. Die unterschiedlichen programmatischen Ziele dieser Parteien führten von Anfang an zu Spannungen. So wurde der Young-Plan*, als er in Kraft treten sollte, von der rechten Opposition heftig bekämpft. DNVP, Stahlhelm und NSDAP bezeichneten ihn als „Versklavung des deutschen Volkes“ und initio Wartende Arbeitslose im Hinterhof des Arbeitsamtes Hannover, Königsworther Platz. Foto von Walter Ballhause, Frühjahr 1932. * Siehe Seite 311. u Geschichte In Clips: Zur Wirtschaftskrise im Deutschen Reich siehe Clip-Code 32019-03 Stahlhelm: Der Stahlhelm wurde im Dezember 1918 gegründet. Ihm konnten alle ehemaligen Soldaten des Ersten Weltkrieges beitreten. 1930 hatte der Verband, der ab 1928 der Weimarer Republik gegenüber immer feindlicher eingestellt war, etwa eine halbe Million Mitglieder. Dem demokratisch geprägten „Reichsbanner Schwarz-RotGold“ gehörten zur gleichen Zeit etwa drei Millionen Mitglieder an. 321Die Zerstörung der Demokratie Nu r z u P üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc ne r V er la gs | |
 « | 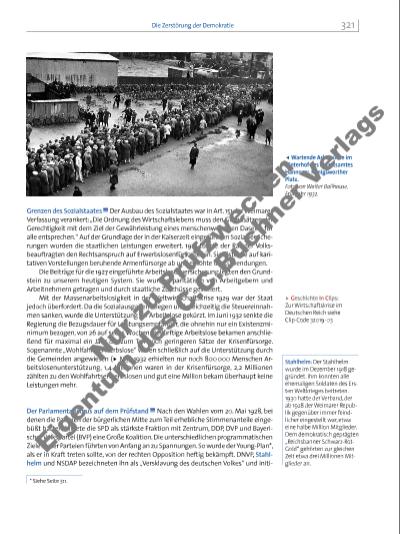 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |