| Volltext anzeigen | |
75Redoxreaktionen – Elektrochemie Red eines Redoxpaares mit kleinerem Potenzial kann Elektronen an Ox eines Redoxpaares mit größerem Potenzial abgeben. Ox eines Redoxpaares mit größerem Potenzial kann Elektronen von Red eines Redoxpaares mit kleinerem Potenzial aufnehmen. Red Ox e– e– In der Spannungsreihe sind die Standard-Elektrodenpotenziale der Redoxpaare aufgelistet. Es gilt: Je kleiner das Standard-Potenzial eines Redoxpaares ist, umso größer ist die reduzierende Wirkung der reduzierten Form (des Reduktionsmittels; Red). Je größer das Standard-Potenzial eines Redoxpaares ist, umso größer ist die oxidierende Wirkung der oxidierten Form (des Oxidationsmittels; Ox). Mithilfe der Spannungsreihe lässt sich der Ablauf von Redoxreaktionen erklären. Auch Voraussagen, ob Re doxreaktionen ablaufen können oder nicht, können getroffen werden. Anwenden der Spannungsreihe zur Formulierung von Voraussagen über den Ablauf von Re doxreaktionen und fachsprachlich korrekte Erläuterung der Reaktionen Kompetenz Aufgabe Zum Ätzen von Kupfer beispielsweise beim Herstellen von Platinen wird eine Eisen(III)-chlorid-Lösung verwendet. 1. Erläutern Sie anhand der Redoxpotenziale, welche Reaktion dabei abläuft. 2. Ermitteln Sie anhand der Spannungsreihe, ob auch eine Eisen(II)-chlorid-Lösung zum Ätzen von Kuper verwendet werden könnte. Lösung Zu 1: Beim Ätzen von Kupfer werden Kupfer-Atome zu Kupfer-Ionen oxidiert, die dadurch aus dem Kupfer herausgelöst werden. Das Potenzial E°(Fe2+/Fe3+) ist größer als das Potenzial des Redoxpaares Cu/Cu2+. Dies bedeutet, dass Kuper-Atome Elektronen an Eisen(III)-Ionen abgeben können unter Bildung von Kupfer(II)-Ionen und Eisen(II)-Ionen. 2 Cu + Fe3+ 2 Cu2+ + Fe2+ Eisen(III)-Ionen oxidieren also Kupfer-Atome, bzw. Kupfer-Atome reduzieren Eisen(III)-Ionen. Zu 2: Beim Ätzen von Kupfer müssen Kupfer-Atome oxidiert werden. Eisen(II)-Ionen stellen im Redoxpaar Fe2+/Fe3+ das Reduktionsmittel dar, im Redoxpaar Fe/Fe2+ das Oxidationsmittel. Da das Poten zial des Redoxpaares Fe/Fe2+ kleiner als das Potenzial des Redoxpaares Cu/Cu2+ ist, können die Eisen(II)Ionen Kupfer-Atome nicht oxidieren. Eine Eisen(II)chlorid-Lösung ist daher zum Ätzen von Kupfer nicht geeignet. KOM PETENZEN ERW ERBEN Red Li+(aq) K+(aq) Na+(aq) Mg2+(aq) Al3+(aq) Ni2+(aq) Pb2+(aq) 2H+(aq) Cu2+(aq) Ag+(aq) Pt2+(aq) Au3+(aq) Li(s) K(s) Na(s) Mg(s) Al(s) Ni(s) Pb(s) H2(g) Cu(s) Ag(s) Pt(s) Au (s) + e– + e– + e– + 2e– + 3e– + 2e– + 2e– + 2e– + 2e– + e– + 2e– + 3e– E° in V –3,04 –2,92 –2,71 –2,36 –1,66 –0,23 –0,13 0,00 +0,35 +0,80 +1,20 +1,41 Ox + z·e– (aq)Fe (aq) + e– +0,772+ Fe3+ Kompetenzen trainieren Diese Kompetenz kann mit den Aufgaben A3, A6 und A7 auf Seite 118 vertieft werden. 122 GR UN DW ISS EN Redoxreaktionen – Elektrochemie Redoxreaktionen Nach dem Donator-Akzeptor-Konzept ist eine Oxidation eine Elektronenabgabe und eine Reduktion ist eine Elektronenaufnahme. Oxidation und Reduktion laufen damit gleichzeitig ab. Reaktionen mit Elektronenübergängen bezeichnet man daher als Redoxreaktionen. Bei einer Redoxreaktion ist das Reduktionsmittel der ElektronenDonator und das Oxidationsmittel der Elektronen-Akzeptor. Das Reduktionsmittel wird bei einer Re doxreaktion oxidiert, das Oxidationsmittel wird reduziert. Nach einer erweiterten Definition ist eine Oxidation eine Erhöhung der Oxidationszahl. Eine Reduktion ist eine Erniedrigung der Oxidationszahl. Die Oxidationszahl ist eine wirkliche oder erdachte (formale) Ladungszahl, die einem Atom in einem Molekül oder einem Ion zugeordnet wird. Spannungsreihe Die unter Standardbedingungen ermittelten Potenziale der Redoxpaare werden in der Spannungsreihe geordnet. Mithilfe der Spannungsreihe können Vorhersagen getroffen werden, welche Redoxreaktionen ablaufen. Je negativer das Potenzial eines Redoxpaares ist, umso stärker reduzierend wirkt die reduzierte Form, je positiver das Potenzial ist, umso stärker oxidierend wirkt die oxidierte Form eines Redoxpaares. Konzentrationszellen Die Redoxpotenziale sind konzentrationsabhängig. In einer Konzentrationszelle, die aus zwei gleichartigen Me/Mez+-Halbzellen unterschiedlicher Konzentration gebildet wird, stellt die Halbzelle mit der kleineren Konzentration den Minuspol dar. Die Halbzelle mit der kleineren Konzentration bildet die Do nator-Halbzelle. Bei Stromfluss fließen die Elektronen zur Akzeptor-Halbzelle. In der Donator-Halbzelle werden die Me tall-Atome oxidiert, in der Akzeptor-Halbzelle werden die Metall-Ionen reduziert. Dies führt allmählich zu einem Konzentra tionsausgleich zwischen beiden Halbzellen. Standardpotenzial Das Standardpotenzial Eo eines Redoxpaares Me/Mez+ ist die Potenzialdifferenz zwischen einer Halbzelle, die dieses Redoxpaar bei Standardbedingungen (c = 1 mol/L; p = 1013 hPa; = 25°C) enthält und einer Standard-Wasserstoff-Halbzelle mit Eo(H2/2 H+) = 0,0 V. Galvanische Zellen Zwei Redoxpaare in räumlich ge trennten Halbzellen, die über eine Elektrolytbrücke, z.B. ein ionendurchlässiges Diaphragma, miteinander verbunden sind, bilden eine galvanische Zelle. Beim Betrieb laufen darin selbsttätig Redoxreaktionen ab. Beispiel Daniell-Element: Minuspol: Zn Zn2+ + 2 e–; Oxidation Pluspol: Cu2+ + 2 e– Cu; Reduktion Zn (s) e– e– Zn2+ (aq) Zn2+ (aq) SO2 – (aq) Cu2+ (aq) e – e– Cu(s) 4 Wasserstoff Me Mez+ (aq) Platin-Elektrode H+(aq) verdünnte ZinksulfatLösung V konzentrierte ZinksulfatLösung Donator-Halbzelle Zn(s) Zn2+(aq)+2e– Zn2+(aq)+2e– Zn(s) Akzeptor-Halbzelle Nernst-Gleichung Die Konzentrationsabhängigkeit des Elektrodenpotenzials wird durch die Nernst-Gleichung beschrieben, die für o.a. Temperatur (Raumtemperatur) und Normdruck die vereinfachte Form annimmt. E = E° + lg Für c(Ox) setzt man die oxidierte Form für c(Red) die reduzierte Form des Redoxpaares ein, wobei man nach den Regeln des MWGs vorgeht. 0,059 V z {c (Ox)} {c (Red)} 103Redoxreaktionen – Elektrochemie Lithium-Polymer-Akkumulator Lithium-Polymer-Akkumulatoren unterscheiden sich von anderen Lithium-Ionen-Akkus hauptsächlich darin, dass sie ohne brennbare flüssige organische ElektrolytLösungen und Separatoren auskommen. Der Ladungsfluss innerhalb der Zellen wird durch leitende Polymere (Kunststoffe) ersetzt. Da das Gehäuse ebenfalls aus Kunststoff ist, kann man den Zellen jede beliebige Form geben und so kleinste Hohlräume in Elektrogeräten nutzen. Der Lithium-Luft-Akku Hinsichtlich der Energiedichte (vgl. S. 101) ist es vielversprechend, Akkus zu bauen, bei denen ein Reaktionspartner nicht im Akku mitgeführt werden muss. In Lithium-Luft-Akkus reagiert an der Kathode Luftsauerstoff, die Anode besteht aus metallischem Lithium. Die Kapazität der Lithium-Luft-Akkus wird lediglich durch die Größe der Lithium-Anode bestimmt. Die Nennspannung in diesen Akkus beträgt 2,96 V, die theoretisch erreichbare Energiedichte ca. 1000 Wh/Kg (ohne Berücksichtigung der Masse des Sauerstoffs). In diesen Akkus wird reversibel Lithiumoxid Li2O gebildet und zersetzt. Dabei wandern bei der Ent ladung Lithium-Ionen von der metallischen LithiumAnode durch einen Elektrolyten zur Kathode und verbinden sich dort mit Sauerstoff-Molekülen zu Lithiumoxid Li2O. Problematisch ist noch die Zahl der Ladezyklen, da unerwünschte Nebenreaktionen ablaufen. Es ist insgesamt zu bedenken, dass die Produkte der Reaktion mit Luft Feststoffe sind. Ein Batterieauto wird während des Betriebs immer schwerer. Das wirkt sich negativ auf die Reichweite pro Batterieladung aus. Im Gegensatz dazu werden Autos mit Verbrennungsmotoren beim Fahren immer leichter, da bei der Verbrennung von Erdgas oder Benzin gasförmige Produkte entstehen. Somit sind sie bezogen auf die Energiedichte bzw. Reichweite noch ungeschlagen (vgl. S. 101, B4). Aufgabe A1 Formulieren Sie die Reaktionsgleichungen für das Laden und Entladen im Lithium-Luft-Akku. ERW EITERUNG·VERTIEFUNG·ANW ENDUNG Kompetenzen Grundwissen Chemie 2000+ Online ist das Internet-Portal zu diesem Buch. Es enthält EVA Online-Seiten und zusätzliche interaktive Materialien zu einzelnen Buchseiten sowie weitere Lehrund Lernmodule für den Unterricht. Auf den Seiten Kompetenzen erwerben wird an exemplarischen Aufgaben gezeigt, welche Kompetenzen bei der Erarbeitung der Inhalte des jeweiligen Kapitels erlangt werden. Auf den Seiten Kompetenzen trainieren werden weitere Aufgaben dazu angeboten. Ein abschließendes Grundwissen fasst die Inhalte der Kapitel strukturiert nach den Basiskonzepten zusammen. Im Anhang ergänzt eine Chemikalienliste das Sicherheitskonzept beim Experimentieren. Ein Glossar ermöglicht schnellen Zugang zu den Definitionen der wichtigsten Fachbegriffe. 3377_01_01_2012_vorsatz_vorn 23.09.14 06:33 Seite 3 ur zu P rü fzw ec k n Ei ge nt m d s C .C . B uc hn er V er la gs | |
 « | 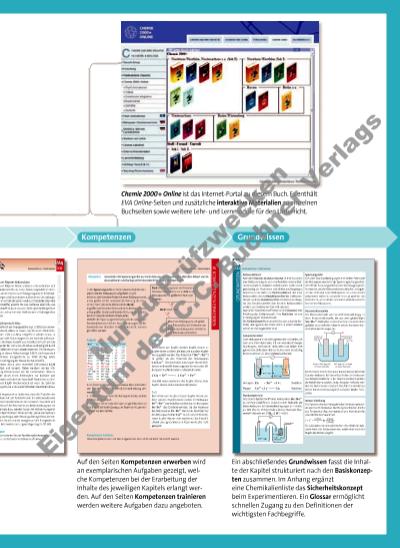 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |