| Volltext anzeigen | |
Der Nationalsozialismus im Spiegel der Geschichtskultur 167 schaft gehören. Dass diese Einstellungen am Ende des Films stehen, entspricht der vom Läuterungskonzept geleiteten Entwicklung der Figuren, die, durch den „Feuersturm“ zum Opfer geworden, „gereinigt“ in die Zukunft entlassen werden. […] Nach einer kurzen Abblende erscheint das Insert „30. Oktober 2005. Weihe der Frauenkirche Dresden“. Zu sehen ist die Totale einer riesigen Menschenmenge auf dem Dresdner Neumarkt, zu hören die Festaktrede des Bundespräsidenten Horst Köhler: „Eine Ruine, eine offene Wunde, über 45 Jahre, ist wiedererstanden. Wiederaufgebaut als ein Zeichen der Versöhnung […]“, gefolgt von „Annas“ Stimme aus dem Off: „Es ist schwer zu begreifen, was damals im Februar 1945 passiert ist, aber jeder, der überlebt hat, hatte die Verpfl ichtung, etwas Neues zu schaffen.“ […] Aussöhnung mit der Vergangenheit ist das zeitgemäße Diktum des Films, der Rede Köhlers wie auch „Annas“ abschließender, 15 mahnender Worte: „Wer immer nur zurückschaut … sieht nichts als seinen Schatten.“ Die „Schatten“ der Vergangenheit sind diesem Gleichnis zufolge für den Aufbruch in die neue Zukunft nur hinderlich. Antonia Schmid, Der „Feuersturm“ als Vollwaschprogramm: Zur Universalisierung des Opfers im Fernseh-Zweiteiler Dresden, in: Kittkritik (Hrsg.), Deutschlandwunder. Wunsch und Wahn in der postnazistischen Kultur, Mainz 2007, S. 141 158 1. Erklären Sie, was Antonia Schmid unter „Viktimisierung“ versteht. 2. Fassen Sie die Hauptkritikpunkte der Autorin am Film „Dresden“ zusammen und diskutieren Sie, ob diese Ihnen angemessen erscheinen. M5 „Schafft diesen Gedenktag wieder ab!“ Der Soziologe Y. Michal Bodemann verfasst am 26. Januar 1999 folgenden Kommentar in der Berliner Tageszeitung taz: Der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz, ist seit 1995 der offi zielle deutsche Gedenktag. Und niemand merkt es. Es könnte alles so schön werden: erst ein ordentlicher Gedenktag für die Opfer, dazu das für den ausländischen Besucher eindrucksvolle Eisenman-Mahnmal1. […] Er scheint als Gedenktag für alle Nazi-Opfer weniger kontrovers: Der 27. Januar erinnert an die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee 1945. Doch zu diesem Zeitpunkt war das KZ nur noch ein Schatten. In den Wochen zuvor hatte sich die Mordmaschinerie verlangsamt, zehn Tage zuvor wurde Auschwitz evakuiert, über 130 000 Häftlinge wurden auf Transporte und Todesmärsche geschickt, und nur ein elendes Überbleibsel von knapp 8 000 Insassen wurde am 27. Januar befreit. […] Der 27. Januar ist ein fernes, konstruiertes Datum, ohne deutsche Erinnerung, in einem anderen Land und ohne deutsche Akteure, denn selbst die SS-Wachmannschaften waren damals bereits verschwunden. Für die Verfolgtenseite mag dieser Tag ein Symbol der Befreiung sein, es waren ihre Angehörigen, die nun das Ende dieses Schreckens vor sich sahen. In Deutschland stand hinter der Entscheidung für diesen Tag offenbar die wohlmeinende, doch naive und beschönigende Idee, in Solidarität mit der Opferseite an das Ende des Mordens zu erinnern. Dadurch, dass der Befreiung von Auschwitz statt seiner Errichtung gedacht wird, stellt sich Deutschland an die Seite der Opfer und der Siegermächte – ein Anspruch, der Deutschen nicht zusteht. Der 27. Januar suggeriert darüber hinaus ein „Ende gut, alles gut“. Ein Tag der Erinnerung für Deutsche soll er sein, doch tatsächlich ist es ein Tag der Zubetonierung von Erinnerung, ein Tag, der den historischen Schlussstrich signalisiert. Wir könnten nun pragmatisch argumentieren: Solange dieser Tag engagiert begangen wird, wäre es ja gut; zumindest besser als gar nichts. Doch der 27. Januar ist eben gerade nicht angenommen worden, er ist ein Tag ohne deutsche Erinnerung geblieben. Die obligatorischen Reden werden zwar gehalten, doch schon bei seiner Einführung 1996 wurden die Feiern im Bundestag um einige Tage vorverlegt, weil es den Abgeordneten so wegen der Urlaubszeit besser passte. Auch 1998 waren die Gedenkfeierlichkeiten Pfl ichtübungen, die in der Mahnmaldebatte untergingen: Über diesen Tag gab es wenig zu sagen, da kam die Mahnmaldebatte gerade recht. Y. Michal Bodemann, 27. Januar: Schafft diesen Gedenktag wieder ab!, in: taz vom 26. Januar 1999 1. Geben Sie zentrale Aussagen Bodemanns mit eigenen Worten wieder. 2. Verfassen Sie eine Rede zum 27. Januar, in der Sie auch Stellung zu den im Text genannten Vorbehalten gegen diesen Gedenktag nehmen. 3. Der Politikwissenschaftler Harald Schmid bezeichnet die Etablierungsgeschichte des 27. Januar – wie auch die des 3. Oktober – als ein Beispiel für etatistische, also vom Staat verordnete, Geschichtspolitik. Beurteilen Sie diese Aussage. 4. Diskutieren Sie folgende These: Wenn der 27. Januar zum internationalen Gedenktag erhoben und damit auf die ganze Welt ausgedehnt wird, bedeutet dies nicht zugleich eine Entlastung für die Deutschen? 35 40 45 50 5 10 15 20 25 30 35 40 1 Gemeint ist das von dem Architekten Peter Eisenman entworfene Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Nu r z u Pr üf zw e ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V rla gs | |
 « | 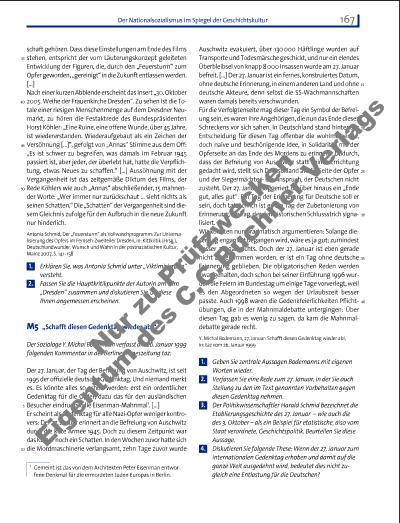 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |