| Volltext anzeigen | |
502 Konfl ikte und Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg Das Ende der Bipolarität Erste Schritte den Annäherung Angesichts des „Gleichgewichts des Schreckens“ entwickelte sich nach der KubaKrise eine neue Sicherheitspolitik. Das Weiße Haus und der Kreml richteten eine direkte Fernschreiberverbindung („Heißer Draht“) ein, die die Kommunikation in Konfl iktfällen sicherstellen sollte. Es entwickelten sich erste Rüstungskontrollvereinbarungen. Sie bezogen sich auf die Beendigung von überirdischen Kernwaffentests zum Schutz von Menschen und Umwelt vor einer weiteren radioaktiven Verseuchung (Atomteststoppabkommen 1963) und auf die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Atomwaffensperrvertrag 1968). Zu Beginn der 1970er-Jahre standen die Zeichen auf Entspannung. Die Sowjetunion suchte die Kooperation mit den USA, um das teure Wettrüsten einzuschränken und an der fortschrittlichen Technologie des Westens teilzuhaben. Außerdem war durch die Annäherung der USA an die Volksrepublik China Bewegung in die Ost-West-Beziehungen gekommen. Ab 1969 führten die beiden Supermächte in Helsinki Verhandlungen über die Beschränkung strategischer Nuklearwaffen (SALT). 1972 wurde das erste SALT-Abkommen unterzeichnet. Es beschränkte die Zahl der atomaren Langstreckenraketen und Raketenabwehrsysteme. Entspannung in Europa Die entspannte Weltpolitik ermöglichte auch die Neue Ostpolitik der Bundesregierung unter Bundeskanzler Willy Brandt. Durch den Moskauer Vertrag (1970), den Warschauer Vertrag (1970) und die innerdeutschen Verträge (1972) stellte sie das Verhältnis zu den osteuropäischen Staaten und zur DDR auf eine neue Grundlage und schuf die Basis für eine begrenzte Zusammenarbeit. Im ViermächteAbkommen (1971) für Berlin konnte eine Verständigung für die Stadt gefunden werden, der Berlin-Krisen für die Zukunft vermied.* Der KSZE-Prozess beginnt Von zentraler Bedeutung war die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Vertreter von 35 Staaten (die USA, Kanada und alle europäischen Länder außer Albanien) verhandelten zwischen 1973 und 1975 in Helsinki über ihre Beziehungen, den Verzicht auf Gewaltandrohung und -anwendung, die bestehenden Grenzen und die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das Ergebnis hielten sie 1975 in der Schlussakte von Helsinki fest (u M1). Vor allem die Bestimmungen über die Menschenrechte wirkten in den kommunistisch regierten Staaten befreiend. Die weiterhin verfolgten und unterdrückten Bürgerrechtler in der Tschechoslowakei, Polen und der DDR konnten sich nun bei Verletzungen ihrer Grundrechte auf die von ihren Staatschefs unterzeichneten Prinzipien der Schlussakte berufen. Sie wurden dabei von den westlichen Medien und Politikern unterstützt. Atomwaffensperrvertrag: (Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons): Der Vertrag wurde von den USA, der Sowjetunion und Großbritannien zwischen 1965 und 1968 ausgehandelt und trat 1970 in Kraft. Inzwischen haben 191 Staaten (Stand: 2015) ihn angenommen. Nicht unterzeichnet haben bislang Indien, Israel, Pakistan und Südsudan. Nordkorea trat im Januar 2003 aus dem Vertrag aus. Er akzeptiert die friedliche Nutzung der Kernenergie, verbietet aber die Verbreitung von Kernwaffen und verpfl ichtet die Mitglieder zur Abrüstung von Kernwaffen. SALT: Abkürzung für „Strategic Arms Limitation Talks“ Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa: Die KSZE wurde 1973 als Gesprächsforum ostund westeuropäischer Staaten, Kanadas und der USA mit dem Ziel gegründet, gemeinsame Projekte in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltschutz und Abrüstung durchzuführen und zur Sicherheit und Durchsetzung der Menschenrechte in Europa beizutragen. Seit 1995 heißt sie „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (OSZE). i „Die Welt ist gerettet.“ Karikatur aus der Wochenzeitung „Die Zeit“ vom 14. Juni 1963 von Paul Flora. * Siehe auch S. 353. 4677_1_1_2015_482-535_Kap14.indd 502 17.07.15 12:19 Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 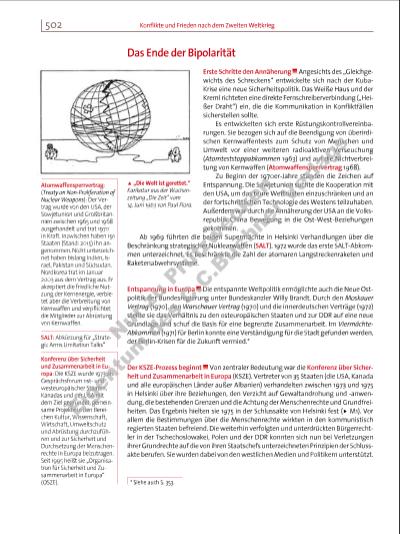 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |