| Volltext anzeigen | |
29710.2 Herausforderungen des demografischen Wandels wird zugleich die Problematik wachsen, über keine ausreichende partnerschaftliche oder familiäre Unterstützung im höheren Lebensalter zu verfügen. 5. Das Arbeitskräftepotenzial schrumpft und altert. Bereits in den nächsten Jahren wird sein Rückgang einsetzen und das Durchschnittsalter der Erwerbsbevölkerung steigen. 6. Zuwanderung und Wachstum des multiethnischen Segments: Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten die Entwicklung zu einer Einwanderungsgesellschaft modernen Typs aus ökonomischen, demografischen und humanitären Gründen fortsetzen. Wegen der niedrigen Geburtenziffer – derzeit 1,4 Kinder pro Frau – würde die Wohnbevölkerung ohne Zuwanderungen von heute 80 Millionen auf 58 Millionen im Jahr 2060 zurückgehen. Aus ökonomischen und demografischen Gründen gehen die Experten daher von erheblichen Zuwanderungen in absehbarer Zukunft aus. Der Zuwanderungsbedarf liegt nach den meisten Schätzungen in den nächsten Jahren bei mindestens 100.000 Personen pro Jahr und ab 2020 in den kommenden Jahrzehnten bei etwa 200.000 pro Jahr. Rainer Geißler, Die Sozialstruktur Deutschlands, 7. Aufl age, 2014, S. 56-58 60 65 70 40 45 50 55 a) Risiken und Befürchtungen Man kann die gängigen Befürchtungen zu den Folgen des demografischen Wandels in einigen zentralen Aussagen zusammenfassen: Die gravierenden unmittelbaren Folgen von verminderter Geburtenneigung und verlängerter Lebenserwartung liegen […] in einer Schrumpfung zuerst der Zahl der Kinder und Jugendlichen und dann der aktiven Bevölkerung sowie einer sprunghaften Zunahme der Alten und Hochaltrigen. Die Verwandtschaftsstrukturen verändern sich, die Generationsspanne wird länger. Kinder haben weniger Geschwister, Onkel und Tanten. Großeltern leben zwar länger, haben aber weniger Enkel. Die Schrumpfung der Bevölkerung wirkt sich auf dem flachen Land und in der Stadt sowie in Ostund Westdeutschland sehr ungleich aus. Dies führt zu wachsenden Unterschieden in der Infrastrukturausstattung. Die zunehmende Schieflage von Beitragszahlern und Rentenempfängern führt zu einer Unterfinanzierung der Alterssicherungssysteme und zu einer massiven Absenkung der Lohnersatzquoten. 30 35 40 45 50 55 5 10 15 20 25 M10 Risiken und Chancen des demografischen Wandels Mit einem höheren Anteil der Alten und Hochaltrigen an der Gesamtbevölkerung steigen auch der Anteil der chronisch und akut Kranken und die Kosten der Krankenund Pflegeversicherungen. […] Durch die sinkende Zahl von Kindern und jungen Erwachsenen wird die Konsumnachfrage gedämpft und das Wirtschaftswachstum gefährdet. […] Die größer werdende Lebensspanne und die geringeren Alterseinkommen erfordern eine Anhebung sowohl des gesetzlichen als auch faktischen RuhestandsEintrittsalters. Die Schrumpfung der Bevölkerung kann nur durch millionenstarke Zuwanderungen ausgeglichen werden. Die sozialen Kosten solcher Migrationen sind nicht zuletzt angesichts vielfältiger kultureller Schranken sehr hoch. Im Übrigen passen sich die Fertilitätsraten von Zuwanderern rasch den Einheimischen an, damit entlasten Zuwanderer die sozialen Sicherungssysteme bestenfalls vorübergehend. Es ist überdies zu befürchten, dass deren oftmals niedrigere Qualifikationsausstattungen zu höheren Soziallasten führen. Lohnersatzquote Die Lohnersatzquote bezeichnet das Verhältnis zum letzten Netto-Arbeitsentgelt bei Transfers mit Lohnersatzfunktion durch eine Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) oder die gesetzliche Unfallversicherung.Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
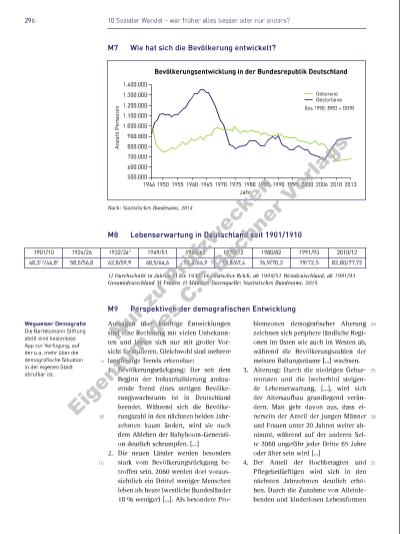 « | 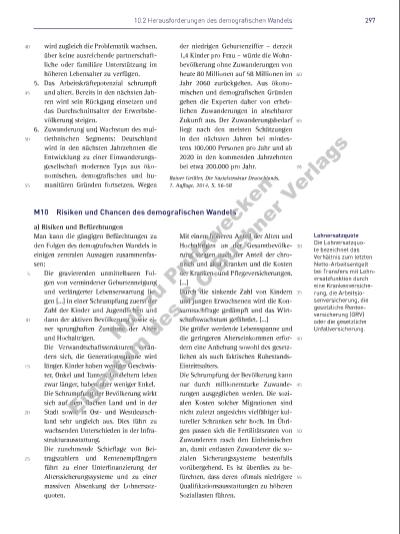 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |