| Volltext anzeigen | |
4 Erkläre die Bedeutungsveränderungen der Begriff e aus dem etymologischen Wörterbuch mithilfe des Kastens. 5 Ordne die Wörter einer der Arten von Bedeutungswandel zu. Nutze folgendes Satzmuster: „Die Bedeutung des heutigen Worts … hat sich im Vergleich zu seiner früheren Verwendung verengt /erweitert /verbessert / verschlechtert /verschoben. Seine frühere Form … bedeutete nämlich …“ Phasen der deutschen Sprachgeschichte Auch wenn die genaue Abgrenzung der einzelnen Phasen recht schwierig ist, gliedert man die Geschichte der deutschen Sprache in folgende Stufen. Die ältesten schriftlichen Überlieferungen einer „deutschen“ Sprache stammen aus dem 8. Jahrhundert. • Althochdeutsche (ahd.) Zeit: ca. 750 bis 1050 • Mittelhochdeutsche (mhd.) Zeit: 1050 bis ca. 1350 • Frühneuhochdeutsche (frnhd.) Zeit: ca. 1350 bis 1650 • Neuhochdeutsche (nhd.) Zeit: ab ca. 1650 Das musst du wissen Etymologie und Bedeutungswandel Im Lauf der Zeit haben sich nicht nur die Schreibweise und die Aussprache der Wörter verändert, sondern auch deren Bedeutung. Man unterscheidet verschiedene Arten des Bedeutungswandels: • Bei der Bedeutungsverengung ist der Umfang der Bedeutungen kleiner geworden. Das Wort muos bezeichnete im Mittelhochdeutschen alle Arten von Speisen. Heute versteht man darunter nur noch eine breiartige Speise. • Eine Bedeutungserweiterung liegt bei dem Wort Horn vor, das im Mittelhochdeutschen nur das Horn des Tiers bezeichnete, heute aber auch für ein Blasinstrument oder ein Trinkgefäß gebraucht wird. • Eine Bedeutungsverbesserung hat das mittelhochdeutsche Wort marschalc (Marschall) für Pferdeknecht erfahren. Heute bezeichnet dieses Wort einen sehr hohen militärischen Rang. • Von Bedeutungsverschlechterung spricht man, wenn ein Wort eine negative Wer tung enthält. Das mittelhochdeutsche Wort merhe bedeutete ursprünglich Pferd. Heute verstehen wir unter einer Mähre ein altes, abgemagertes Pferd. • Eine Bedeutungsverschiebung liegt vor bei dem Wort Flaschenhals: Die Bezeichnung für den Körperteil „Hals“ wird hier auch auf nichtmenschliche Objekte (den „Flaschenhals“) übertragen. Das musst du wissen toll: mhd. tol, ahd. tol, mittelniederdeutsch dwal „töricht“. Ableitungen aus germanisch *dwela „verwirrt sein“ Kragen: mhd. krage „Hals, Hals beklei dung“ stark: mhd. starc, ahd. starc. Die Ausgangs bedeutung scheint „starr“ zu sein. Sprachgeschichtliche Zusammenhänge erkennen 171 Sprache versteh en und ver wenden : Wortsch atz ➞ AH S. 40 f. 11077_1_1_2016_166_177_09.indd 171 26.08.16 12:28 Nu r z u Pr üf zw ec k n Ei en tu m es C .C .B uc hn er V er la gs | |
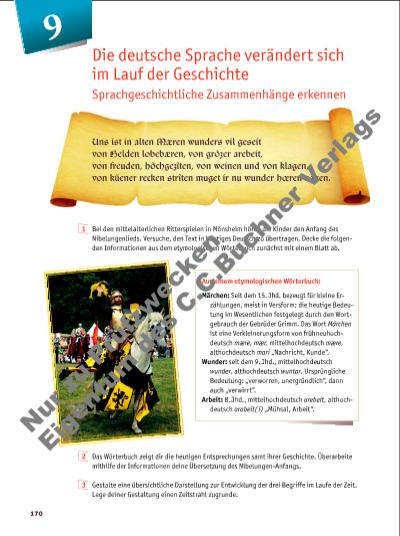 « | 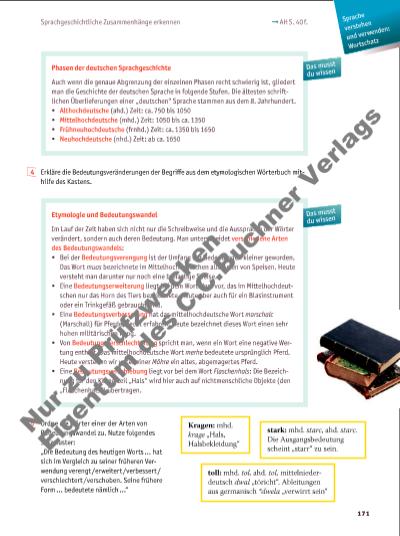 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |