| Volltext anzeigen | |
Marktes, der freie Wettbewerb und das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage würden das Gemeinwohl fördern, da nur solche Güter und Dienstleistungen bestehen blieben, für die auch eine Absatzmöglichkeit vorhanden sei. Die Lehre des Wirtschaftsliberalismus wies auch dem Staat eine neue Rolle zu. Der Staat dürfe die wirtschaftlichen Prozesse nicht nach eigenen Interessen steuern, wie das im Merkantilismus geschah. Vielmehr müsse er sich darauf beschränken, günstige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Die Ausgangslage in Deutschland um 1800 Im Vergleich zu Großbritannien setzte die Industrialisierung in Deutschland deutlich später ein. Das hatte mehrere Ursachen. Um 1800 bestand das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aus rund 300 Teilstaaten, die eine unterschiedliche Wirtschaftsund Handelspolitik betrieben. Eine Vielzahl verschiedenartiger Maß-, Münzund Gewichtssysteme wie auch die vielen Zollund Mautgrenzen behinderten den überregionalen Handel. Zwar wurde durch die Neuordnung Deutschlands auf dem Wiener Kongress (1814/15) die Zahl der Einzelstaaten auf 38 reduziert, Handelshemmnisse blieben jedoch bestehen. Das ökonomische Denken vieler Herrscher in Deutschland war noch vom Merkantilismus geprägt. Durch staatliche Eingriffe wie Zölle, Einund Ausfuhrverbote sowie Handelsmonopole und Stapelrechte sollten die eigenen Kaufl eute und Handwerker geschützt und die Wirtschaftskraft des eigenen Staates gestärkt werden. Diese Maßnahmen behinderten aber den freien Handel zwischen den deutschen Staaten, zulasten größerer Betriebe, die für einen überregionalen Markt produzieren wollten. Die Zünfte, die seit dem Mittelalter bestehenden Zusammenschlüsse der Handwerker in einer Stadt, sicherten ihren Mitgliedern zwar ein gewisses Einkommen, setzten jedoch dem unternehmerischen Streben des Einzelnen deutliche Grenzen. Sie reglementierten nicht nur die Zahl und Größe der einzelnen Betriebe an einem Ort, sondern versuchten auch, den Verkauf aller von außerhalb kommenden Handelserzeugnisse zu verhindern. Da die deutschen Staaten im Gegensatz zu England oder Frankreich keine Kolonien besaßen und mit Ausnahme einiger großer Städte wie Hamburg oder Bremen keinen Überseehandel betrieben, fehlten billige Rohstoffe und zusätzliche Absatzmärkte (u M2). Als weiteres Hemmnis erwies sich das im Vergleich zu Großbritannien wesentlich schlechter ausgebaute Verkehrswesen. Die Mobilität der Einwohner war in Deutschland weit geringer als in Großbritannien. Viele der auf dem Land lebenden Menschen konnten aufgrund rechtlicher Bindungen den Grund und Boden, den sie bewirtschafteten, nicht ohne Weiteres verlassen. Bauernbefreiung und Gewerbefreiheit Um mit anderen Ländern konkurrenzfähig zu sein, musste insbesondere die Wirtschaftsund Sozialordnung in den deutschen Staaten modernisiert werden. In wirtschaftlicher Hinsicht standen zwei Vorhaben im Zentrum der Reformbemühungen: die Bauernbefreiung und die Einführung der Gewerbefreiheit. Geschwindigkeit und Stufen der Reformen waren in den einzelnen Territorien jedoch sehr unterschiedlich. Begonnen hatten sie mancherorts bereits an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, vollendet wurden sie teilweise erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Preußen übernahm dabei eine Vorreiterrolle. Dort setzten Heinrich Friedrich Carl Freiherr vom und zum Stein, dem durch eine längere Reise die Verhältnisse in England bekannt waren, sowie der preußische Außenminister und StaatsStapelrecht: Recht einer Stadt, wonach vorbeiziehende Kaufl eute ihre Waren für eine bestimmte Zeit zum Verkauf ausstellen mussten. Dabei hatten die Bürger der Stadt das Vorkaufsrecht. Mit einer Abgabe konnten sich die Kaufl eute vom Stapelzwang freikaufen. i Freiherr vom und zum Stein. Gemälde von Johann Christoph Rincklake, 1804. Heinrich Friedrich Carl Freiherr vom und zum Stein (1757 1831): geboren in Nassau an der Lahn, stammte aus einem Rittergeschlecht, seit 1780 im preußischen Staatsdienst. Seit September 1807 Leitender Minister in Preußen, gut ein Jahr später auf Betreiben Napoleons wieder entlassen. Stein ging nach Russland, wo er bis 1815 politischer Berater des Zaren war. Er starb 1831 in Cappenberg (Westfalen). 181Liberalisierung durch staatliche Reformen N r z u Pr üf z ec en Ei ge nt um d s C .C .B uc hn er Ve rla gs | |
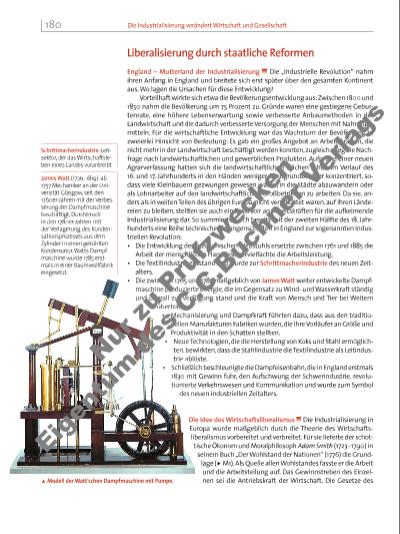 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |