| Volltext anzeigen | |
Einkommensverlusten. Der armselige Alleinmeisterbetrieb, in dem Frau und Kinder mitarbeiteten, der aber keine Gesellen oder Lehrlinge ernähren konnte, prägte vielerorts das Bild. Auch die industrielle Konkurrenz – zunächst aus dem Ausland, bald aber auch aus Deutschland – setzte dem Handwerk besonders im Bereich der Textilproduktion und der Metallverarbeitung schwer zu, da sie effektiver und billiger produzieren konnte. Erst nach Jahrzehnten der Umorientierung fanden Handwerker Ersatz für die ihnen an die neuen Fabriken verloren gegangenen Produktionsbereiche: Sie verlegten sich auf die Reparatur und das Verkaufsgeschäft, aber auch auf die Produktion solcher Güter, die nicht massenweise in den Fabriken hergestellt werden konnten, oder auf die Weiterverarbeitung von Fabrikware. Ein Beispiel ist der Textilbereich, in dem Massenproduktion in der Fabrik (Spinnerei und Weberei) und handwerkliche Kleiderschneiderei Hand in Hand arbeiteten und voneinander profi tierten. Auf diese Weise veränderte sich das Berufsbild des Handwerkers im Lauf des 19. Jahrhunderts grundlegend. Licht … Überblickt man die Reformen in Landwirtschaft und Gewerbe insgesamt, so waren trotz aller regionalen Unterschiede die langfristigen Folgen revolutionär: • Die Liberalisierung schuf neue Möglichkeiten der freien Entfaltung und der individuellen Lebensgestaltung: Viele der auf dem Land lebenden Menschen konnten bisher aufgrund rechtlicher Bindungen den Grund und Boden, den sie bearbeiteten, nicht ohne Weiteres verlassen. Dies war nun möglich. Sie konnten Wohnort und Beruf frei wählen, einen Betrieb gründen und frei über ihre Arbeitskraft und ihre Zeit verfügen. • Durch die Aufhebung der Heiratsbeschränkungen konnte jeder unabhängig von Verdienst und Besitz eine Familie gründen. • Darüber hinaus garantierten die Reformen Rechtsgleichheit für alle. Sie setzten damit eine Entwicklung fort, die mit der Übernahme des napoleonischen Code Civil* in den Rheinbundstaaten begonnen hatte. ... und Schatten • Die Reformen hoben zwar die feudalen Abhängigkeitsverhältnisse auf dem Land auf und bauten die zünftischen Beschränkungen in den Städten ab, durch die Loslösung von Grundherrschaft und Zunftverfassung verloren viele Menschen jedoch den gewohnten Schutz ihres Grundherrn bzw. ihrer zünftischen Genossenschaft. Sie waren nun nicht nur frei, sondern in einer neuen Weise für sich selbst verantwortlich, und spürten die Gesetze von Markt und Wettbewerb deutlicher als früher. • Seit ab 1802/03 die meisten Klöster und später die Zünfte aufgehoben wurden, mussten die Gemeinden viele ihrer früheren Aufgaben übernehmen. Dazu gehörte die Krankenund Armenfürsorge. Jeder neue „Ansässige“ war damit eine potenzielle Belastung für die örtlichen Armenkassen, ein Risiko, das die Gemeinden möglichst kleinhalten wollten. Als um 1830 wirtschaftliche Krisen Armut und Bettel ansteigen ließen, wurde die „Ansässigmachung“ noch erschwert. Daran hatte auch das örtliche Handwerk Interesse, das sich auf diese Weise gegen unliebsame Konkurrenz schützen konnte. Die Zahl der unehelich Geborenen stieg. Je nach Region dauerte es noch viele Jahre, bis es trotz Aufhebung der Heiratsbeschränkungen möglich war, unabhängig von Einkommen und Besitz eine Familie zu gründen. i Die Gewerbefreiheit und ihre Konsequenzen. Humoreske von Herbert König in der Leipziger Illustrirten Zeitung vom 15. Februar 1862 (Ausschnitte). In der Zunftlade wurden die wichtigsten Dokumente der Zunft, wie etwa die Zunftordnung, verwahrt. Mit „Berliner Industrielle“ sind fl iegende Händler gemeint. Einige verrostete Zünftler sitzen noch immer bei „offener Lade“ und verstehen die Welt nicht mehr. Es zeigen sich bereits die bekannten Berliner Industriellen. Weshalb die Anmeldungen zu Konzessionen sich in bedenklicher Weise mehren. * Siehe dazu Seite 226. 185Liberalisierung durch staatliche Reformen Nu r z u Pr üf zw ck en E g nt um d es C .C .B uc hn er V rla gs | |
 « | 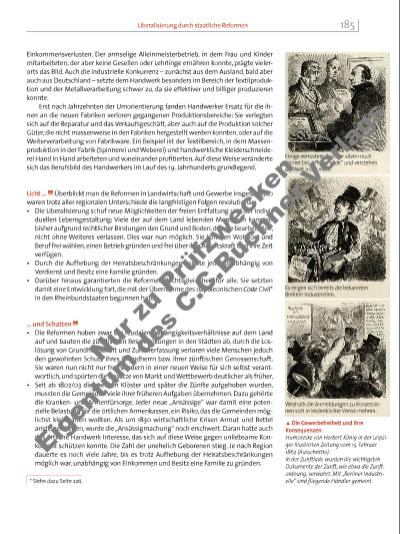 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |