| Volltext anzeigen | |
Mitternachtsblau – die Folgen der globalen JeansproduktionM 3 Vor zehn Jahren war Zhongshan eine Ansammlung von mehreren Dörfern, Ententeichen und Feldern. Heute gibt es hier 5.000 Textilfabriken unterschiedlicher Größe, die jeden Schritt der Jeansherstellung abdecken, vom Weben und Färben bis zum Nähen und der Nachbearbeitung. Das Wachstum der Stadt orientierte sich dabei so sehr an der Industrie, dass es zwecklos ist, einem Taxifahrer einen Straßennamen zu nennen. Nennt man ihm aber den Namen einer Firma, bringt er einen umgehend dorthin. Die Fabrikanten stammen genauso wie die Arbeiter aus armen Dörfern im Westen Chinas. Sie sind ins Delta des Pearl River gegangen, eine Region in der Provinz Guangdon in der Nähe von Hongkong, um ihr Glück in der Industrie zu suchen. China ist zum größten Jeansproduzenten der Welt aufgestiegen. Der jährliche Umsatz dieses Industriezweigs wird auf zweistellige EuroMilliardenbeträge geschätzt. Aber die Arbeiter zahlen für diese Erfolgsgeschichte einen hohen Preis. Stof e für Kleidung werden in der Regel erst gewebt und dann gefärbt. Bei der Denim-Produktion aber ist es andersherum. Die Arbeiter beladen zuerst of ene Wannen voller „Sulphur Black“ oder anderen Färbemitteln mit dem Garn. Je dunkler die Färbung werden soll, umso mehr Chemikalien werden benötigt. Dann werden die Fasern mit Ätznatron und Säure behandelt, um die Aufnahme der Farbe zu verbessern. Meist sind die Arbeiter gegen die zersetzenden Dämpfe nicht geschützt. Danach wird der Denimstof gewebt, zugeschnitten und zu einer Jeans vernäht. Auch hier wimmelt es von Gefahren, wenn Näher und Näherinnen bis zu 18 Stunden am Tag die Highspeed-Nähmaschinen mit dem schweren Jeansstof füttern. Sie werden pro Stück bezahlt. Das Durchschnittseinkommen von 150 Euro im Monat ist höher als in den meisten anderen Industriezweigen. Aber um dieses zu erreichen, müssen sie unnachgiebige Produktionsquoten erfüllen. Dafür riskieren sie Arbeitsunfälle oder Augenprobleme und Rückenschmerzen durch Überanstrengung. Dou Yongwen ist 24 Jahre alt. Seit acht Jahren stanzt er fast jeden Tag 10.000 Knöpfe in Jeans. „Das ist kein Leben“, sagt er. Aber er zahlt diesen Preis in der Hof nung auf eine bessere Zukunt . „Ich versuche, den Handel zu verstehen. In ein paar Jahren habe ich hof entlich genug Geld gespart, um mich mit einem Knopb etrieb selbstständig machen zu können.“ Die goldene Zukunt hat sich bislang für Dou aber noch nicht eingestellt. Die einzige Pause in der letzten Zeit hatte er, als nach einem langen Arbeitstag bis Sonnenaufgang seine Konzentration nachließ und die Maschine seinen Finger durchstanzte. Die Lage der Arbeiter verbessert sich nur langsam. Doch mit zunehmendem Lebensstandard, Bildung und internationalen Arbeitsbestimmungen wird es für Ausbeuterbetriebe immer schwieriger. Mit Chinas Verwandlung in einen Industriegiganten steigt die Nachfrage nach gut ausgebildeten Krät en derart, dass sie das Angebot weit übersteigt. Und seitdem auch Arbeiter Mobiltelefone haben, machen Informationen über ausbeuterische Praktiken schnell die Runde. Nach: Justin Jan, Greenpeace Magazin 03.08 Macht und sind uns daher ohnmächtig ausgeliefert.“ Het ig gestritten wird darüber, wie man das Prinzip der Nachhaltigkeit mit wirtschat lichem Wohlstand und gerechter Verteilung der Güter in Einklang bringen kann. Im Zentrum der Debatten über Nachhaltigkeit steht deshalb in der Regel das Begrif sdreieck (die Trias) Ökologie – Ökonomie – Soziales. Das heißt, dass alle Maßnahmen auf ihre ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen zu untersuchen sind. Nach: Stephan Podes, Politik & Co. Nordrhein-Westfalen 2, Bamberg, S. 302 30 5 10 15 20 25 30 35 35 40 45 50 55 60 65 70 Nicht-erneuerbare Ressourcen Rohstoffe, deren Entstehung sich nicht in menschlichen Zeitmaßstäben vollziehen und daher endlich sind (z. B. Erdöl). 19 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
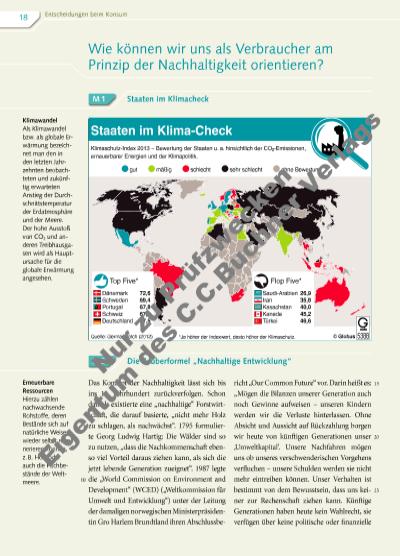 « | 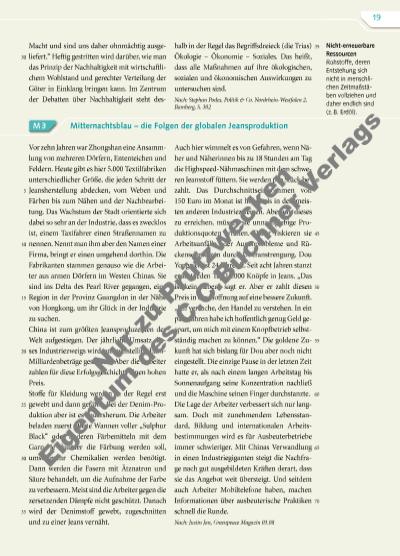 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |