| Volltext anzeigen | |
Die Wilhelminische Gesellschaft 133 1 Parade im Lustgarten 9. 2. 1894. Tafelbild nach einem Original von Carl Röchling, um 1900. Dargestellt sind Kaiser Wilhelm II. und das Erste Garde-Regiment zu Fuß in Potsdam.Der Kaiser und „seine“ Zeit Die Epoche zwischen 1890 und 1914 verdankt ihre Bezeichnung Kaiser Wilhelm II. 1888 war sein Vater, Friedrich III., seinem Großvater, Wilhelm I., auf den Thron gefolgt. Friedrich starb nach nur 99 Tagen Regierungszeit. Sein Sohn hatte daraufhin im so genannten Drei-Kaiser-Jahr die Regentschaft übernommen. Nach zwei Regierungsjahren hatte Wilhelm II. 1890 den Rückritt Bismarcks durchgesetzt. Seine Entscheidung fand damals kaum Widerspruch. Der alte Reichs kanzler schien die innenund außenpolitischen Probleme des inzwischen zu einer führenden Industrienation herangewachsenen Deut schen Reiches nicht mehr lösen zu können. Wilhelm II. sorgte bald für zahlreiche innenund außenpolitische Verwirrungen. Der Monarch war sprunghaft und geltungssüchtig, trat am liebs ten in Uniform auf und hielt viele kriegerische und ungeschickte Reden. Er berief sich dabei ständig auf sein Gottesgnadentum und glaubte, ein „persönliches Regiment“ führen und die Reichspolitik selbst leiten zu können. Eine „Ein-Viertel-Gesellschaft“? Die gesellschaftliche Elite der Industrienation bildete wie 100 Jahre zuvor der Adel. Er nahm noch immer die höchs ten Ämter in Verwaltung, Dip lomatie und Armee ein. Gleichzeitig hatte er sich auf die neuen wirtschaft lichen Verhältnisse eingestellt; Adlige beteiligten sich an Industrieunternehmen und Banken. Neben dem Adel stand das Großbürgertum, die dünne Schicht der Unternehmer und Bankiers. Diese hatten mit dem wirtschaftlichen Wachstum an politischem Selbstbewusstsein gewonnen und übten ihrerseits Einfluss auf die adlige Machtelite aus. Durch den Ausbau von Verwaltung und Justiz, des Bildungsund Gesundheitswesens sowie durch die steigenden Anforderungen der Industrie und Technik war das Bildungsbürgertum stark gewachsen. Zum „alten“ städtischen Mittelstand, den Handwerkern und Händlern, trat um die Jahrhundertwende ein „neuer“: die Angestellten. Sie grenzten sich deut lich von den Arbeitern ab. Der soziale Aufstieg aus der Arbeiterschaft blieb schwierig. Ein ungelernter Arbeiter hatte die Chance, Facharbeiter oder Angestellter zu werden, aber der Sprung ins Besitzund Bildungsbürgertum war die Ausnahme. Dafür sorgte das Bildungssys tem. Der Besuch von Gymnasien und Universitäten kostete Geld und setzte ein ausreichendes Einkommen der Eltern voraus. Darüber verfügte nur ein Bruchteil der Gesellschaft. Rund drei Viertel der Wilhelminischen Gesellschaft lebten am Rande des Existenz minimums. 4743_129_144_q7.qxd 12.08.2016 8:06 Uhr Seite 133 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc h er V er la gs | |
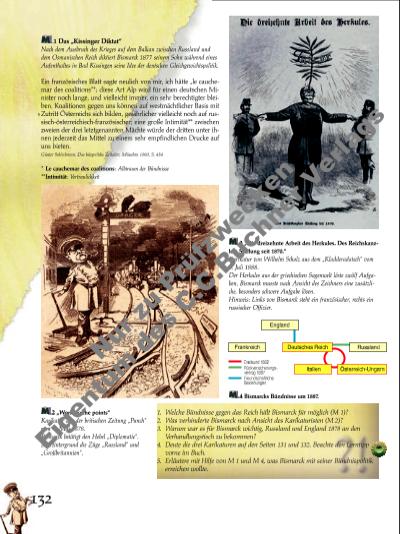 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |