| Volltext anzeigen | |
M4 Christentum und Philosophie a) Der griechische Theologe Clemens von Alexandria vertritt um 200 n. Chr. die christliche Position zur heidnischen Bildung: Es war vor der Ankunft des Herrn die Philosophie den Griechen zur Rechtschaffenheit notwendig; jetzt aber wird sie nützlich für die Gottesverehrung, indem sie eine Art Vorbildung für die ist, die den Glauben durch Beweise gewinnen wollen […]. Urheber alles Guten nämlich ist Gott, sowohl des Guten, das unmittelbar gut ist, wie das Alte oder Neue Testament, als auch des Guten, das nur durch Beziehung auf etwas anderes gut ist, wie die Philosophie. Vielleicht wurde die Philosophie den Griechen aber auch als etwas unmittelbar Gutes gegeben zu jener Zeit, als der Herr die Griechen noch nicht berufen hatte; auch sie erzog nämlich das Griechenvolk auf Christus wie das Gesetz die Hebräer. Demnach bereitet die Philosophie denjenigen, der von Christus vollendet werden soll, vor, indem sie ihm den Weg bereitet. […] Wie aber die allgemeinen Wissenschaften zusammenarbeiten für ihre Herrin, die Philosophie, so wirkt die Philosophie selbst zum Erwerb der Weisheit. Zitiert nach: Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi, Bd. 1, Basel 1951, S. 174 und Weisheit der Väter. Ein Kirchenväterbrevier, aus dem Griech. und Lat. von Heinrich Kraft, Hamburg 1957, S. 176 b) Augustinus, der sich in mehreren Werken zu seiner frühen Vorliebe für Platons Lehren bekennt, hinterfragt im 5. Jahrhundert die Logik heidnischer Philosophie vor dem Hintergrund christlicher Erkenntnislehre: Wenn also Plato sagte, weise sei, wer diesen Gott nachahme, erkenne und liebe, und glückselig, wer an ihm teilhabe, wozu dann noch die übrigen durchmustern? Keine anderen sind uns so nahe gekommen wie er und seine Schule. […] Also nicht nur der gesamte Inhalt der beiden Theologien, der fabulierenden und staatlichen, möge den platonischen Philosophen das Feld räumen, die den wahren Gott, den Urheber aller Dinge, den Offenbarer der Wahrheit, den Spender der Glückseligkeit lehrten, sondern auch die anderen Philosophen, die, irdisch gesinnt, körperliche Urgründe der Natur mutmaßten, wie Thales die Feuchtigkeit, Anaximenes1 die Luft, […] Epikur die Atome, das sind kleinste Körperchen, die man nicht teilen und wahrnehmen kann, desgleichen alle anderen […], mögen sie nun einfache oder zusammengesetzte, leblose oder lebende Körper, jedenfalls aber Körper als Ursache und Urgrund der Dinge bezeichnen […]. Mögen also, wie gesagt, auch diese Philosophen den Platonikern das Feld räumen, desgleichen diejenigen, die sich zwar schämten, Gott als körperlich zu denken, aber meinten, unsere Seelen seien gleichen Wesens wie er, ohne sich durch ihre große Wandelbarkeit abschrecken zu lassen, die man doch dem göttlichen Wesen unter keinen Umständen zuschreiben darf. Doch man sagt: Die Wandlungen der Seele sind körperlich bedingt, an sich ist sie unwandelbar. Nun, so könnten sie auch sagen: Die Verwundung des Fleisches ist körperlich bedingt, an sich ist es unverwundbar. Nein, was unwandelbar ist, kann durch nichts umgewandelt werden […]. Augustinus, Über den Gottesstaat (De civitate Dei), Buch 11 bis 22, aus dem Lateinischen übertragen von Wilhelm Thimme, München 1978, S. 378 und 380 f. 1. Erläutern und vergleichen Sie die Standpunkte von Clemens von Alexandria und Augustinus zur griechischen Philosophie. Wie argumentieren beide jeweils? 2. Ermitteln Sie, wie sie die antiken Lehren wiedergeben. Welche Ziele verfolgen sie mit ihren Über legungen? 1 Anaximenes (um 585 528/24 v. Chr.) war ein griechischer Naturphilosoph aus Milet. Er nahm die Luft als Grundbaustein der Welt an. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 i Der Heilige Augustinus überreicht Gott sein Buch. Illustration aus der französischen Übersetzung von Augustinus’ Werk „De Civitate Dei“ („Vom Gottesstaat“) von Raoul de Presles, 14. Jahrhundert. 19Antike Grundlagen europäischen Denkens im Überblick Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
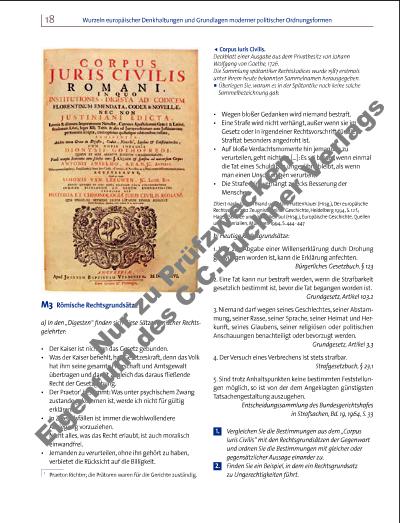 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |