| Volltext anzeigen | |
Der Nationalsozialismus im Spiegel der Geschichtskultur 161 Skandal und Wandel in der Bundesrepublik – Ritualisierung in der DDR Die dritte Phase, die „Phase der Vergangenheitsbewältigung“, dauerte vom Ende der 1950erbis zum Ende der 1970er-Jahre und zeichnete sich besonders in der Bundesrepublik scharf von den vorherigen Phasen ab. Langsam setzte ein Umdenken ein. Orte des NS-Terrors, etwa frühere Konzentrationslager wie Dachau, wurden zu Gedenkstätten, auch gewann der Nationalsozialismus in westdeutschen Lehrplänen sowie in der politischen Bildung zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig wurde die bundesdeutsche Öffentlichkeit buchstäblich im Gerichtssaal über die Verbrechen des Nationalsozialismus aufgeklärt. So schrieb der Schriftsteller Martin Walser zum Abschluss des Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 1965: „Der Prozess gegen die Chargen von Auschwitz hat eine Bedeutung erhalten, die mit dem Rechtsgeschäft nichts mehr zu tun hat. Geschichtsforschung läuft mit, Enthüllung, moralische und politische Aufklärung einer Bevölkerung, die offenbar auf keinem anderen Wege zur Anerkennung des Geschehenen zu bringen war.“ Die Gerichtsverhandlungen der 1960er-Jahre stellten das in der westdeutschen Gesellschaft gängige Täter-Bild infrage und präzisierten die Vorstellungen von der Funktionsweise des nationalsozialistischen Regimes. Der Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem zeigte, dass nicht nur „eine kleine Clique um Hitler und Himmler“ und einzelne brutale „Exzesstäter“ oder „menschliche Randexistenzen“ für den Massenmord an den Juden Europas verantwortlich waren, sondern auch ein Heer unscheinbarer Bürokraten in einem breit gefächerten Institutionennetz, welches Eichmann koordinierte – ein „Verwalter, dessen Ressort das Morden“ war, wie „Die Zeit“ damals schrieb. Während sich in der DDR der ritualisierte antifaschistische Bezug auf den Nationalsozialismus nur in Nuancen wandelte und öffentliche Kontroversen ohnehin nicht möglich waren, spitzte sich in der Bundesrepublik in den 1960er-Jahren die Auseinandersetzung um die Vergangenheit zu. Dem Verschwiegenheitskomplott einer Gesellschaft, deren tragende Stützen immer noch Sechzigjährige waren, welche häufi g im Nationalsozialismus ihre Karriere begonnen hatten, trat eine neue Generation Historiker, Journalisten, Juristen oder politisierter Bürger entgegen. Vieles wurde skandalisiert. Hierzu gehörte auch, dass der Bundestag am 1. Dezember 1966 mit Kurt Georg Kiesinger ein ehemaliges NSDAP-Mitglied zum Bundeskanzler wählte. Im Mai 1968 wurden dem Bundestag einige wenig spektakulär wirkende Gesetzesvorlagen, die sich mit Ordnungswidrigkeiten befassten, zur Abstimmung zugeleitet. Zusätzlich ging es auch um die Neuformulierung des Paragrafen 50, Absatz 2 des Strafgesetzbuches. Für die Strafverfolgung nationalsozialistischer Verbrecher war die Novellierung des Beihilfe-Paragrafen ein Desaster: Da im bundesdeutschen Rechtsverständnis als Haupttäter immer Hitler, Himmler, Heydrich u. a. galten, wurde die Masse der Schreibtischtäter stets nur wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Aufgrund der Novelle mussten viele Prozesse und Ermittlungsverfahren eingestellt werden – unter anderem auch die schon seit sechs Jahren andauernden Ermittlungen gegen etwa 300 Täter des Reichssicherheitshauptamtes. Was in der offi ziellen Sprachregelung als „Panne des Gesetzgebers“ galt, nannte die kritische Öffentlichkeit „kalte Amnestie“. Im gleichen Jahr wurde mit Hans-Joachim Rehse einer der am schwersten belasteten Richter des Volksgerichtshofes freigesprochen. Seine Todesurteile hätten damals der legitimen Selbstbehauptung des Staates gedient, so die Begründung des Freispruchs von 1968. Einen Sturm der Entrüstung entfachte der Hinweis des Gerichtes, dass sich der Staat auch heute mit härteren Strafen gegen Demonstranten wehren müsse. Die gingen daraufhin wieder auf die Straße und verglichen den Freispruch mit der einjährigen Gefängnisstrafe, die Beate Klarsfeld bekommen hatte, nachdem sie Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger aufgrund seiner früheren NSDAP-Mitgliedschaft mit den Rufen „Nazi, Nazi!“ geohrfeigt hatte. Beate Klarsfeld: geb. 1939 in Berlin, lebt in Paris. Die Journalistin provozierte Skandale um etablierte Ex-Nazis und half, Massenmörder wie Kurt Lischka und Klaus Barby vor Gericht zu bringen. Sie ist „Offi zierin der Ehrenlegion“ Frankreichs und trägt die israelische „Tapferkeitsmedaille der Ghettokämpfer“. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes wurde bislang abgelehnt. Paragraf 50, Absatz 2 des Strafgesetzbuches: Diese Strafgesetzbuchänderung erklärte den Tatbestand „Beihilfe zum Mord aus niederen Beweggründen“ rückwirkend seit 1960 straffrei. i „Rosen für den Staatsanwalt.“ Plakat von 1959. Der Film „Rosen für den Staatsanwalt“ (Regie: Wolfgang Staudte; Dar steller: Martin Held, Walter Giller u. a.) kam 1959 in die bundesdeutschen Kinos. Thema ist die Verdrängung der NS-Vergangenheit eines Kriegsrichters in der Bundesrepublik. Staudte erhielt dafür 1960 den Bundesfi lmpreis, lehnte ihn aber ab. Nu r z P üf zw ec ke n E g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 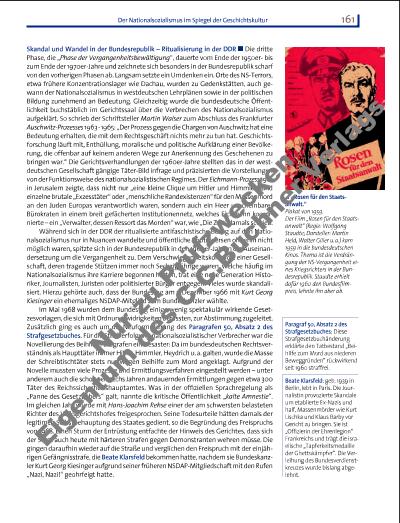 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |