| Volltext anzeigen | |
319Die deutsche Nachkriegsgeschichte im Spiegel der Geschichtskultur ständnis der DDR die Stasi wichtiger sei als die Kinderkrippe. In diesem Erinnerungsmodus wird den fundamentalen Unterschieden zwischen politischer Freiheit und politischer Unterwerfung ein entschieden höherer Wert für die Würde des menschlichen Lebens zugemessen als den sozialen und wirtschaftlichen Gratifi kationen [...]. Stattdessen setzt sich die auf den Unrechtscharakter der SED-Herrschaft ausgerichtete Erinnerung dafür ein, in erster Linie die Schreckensorte der kommunistischen Herrschaft von den sowjetischen Internierungslagern und KGB-Gefängnissen bis zum Überwachungsund Bespitzelungssystem der Staatssicherheit im Bewusstsein der Nachwelt präsent zu halten. Das Diktaturgedächtnis ist auf den Täter-Opfer-Gegensatz fokussiert. Es räumt Verbrechen, Verrat und Versagen unter der SED-Herrschaft hohen Stellenwert ein und sieht in der Erinnerung an Leid, Opfer und Widerstand die wichtigste Aufgabe einer Vergangenheitsbesinnung, die im Dienst der Gegenwart Lehren aus der Geschichte ermöglichen und so vor historischer Wiederholung schützen soll. Entsprechend ist das Diktaturgedächtnis normativ und teleologisch1 strukturiert; es zeichnet die DDR als negatives Kontrastbild vor der Folie rechtsstaatlicher Normen und Freiheitstraditionen [...]. Während dieses staatlich approbierte DDR-Bild den Raum der öffentlichen Erinnerung beherrscht, wirkt ein zweites Organisationsmuster der DDR-Erinnerung stärker in die gesellschaftliche Tiefe und pocht hier mit stillem Trotz und dort mit lauter Vehemenz auf sein Eigenrecht. Dies ist ein in Ostdeutschland bis heute vielfach dominantes Arrangementgedächtnis, das vom richtigen Leben im falschen weiß und die Mühe des Auskommens mit einer mehrheitlich vielleicht nicht gewollten, aber doch als unabänderlich anerkannten oder für selbstverständliche Normalität gehaltenen Parteiherrschaft in der Erinnerung hält. Das Arrangementgedächtnis verknüpft Machtsphäre und Lebenswelt. Es erzählt von alltäglicher Selbstbehauptung unter widrigen Umständen, aber auch von eingeforderter oder williger Mitmachbereitschaft und vom Stolz auf das in der DDR Erreichte – kurz, es verweigert sich der säuberlichen Trennung von Biografi e und Herrschaftssystem, die das Diktaturgedächtnis anbietet, und pfl egt eine erinnerungsgestützte Skepsis gegenüber dem neuen Wertehimmel des vereinigten Deutschland, die zwischen ironischer Anrufung und ostalgischer Verehrung der ostdeutschen Lebensvergangenheit oszilliert. […] Noch stärker im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung existiert schließlich ein weiteres Erinnerungsmuster, das an der Idee einer legitimen Alternative zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung festhält. Dieses Fortschrittsgedächtnis denkt die DDR vor allem von ihrem Anfang her. Es baut seine Erinnerungen auf der vermeintlichen moralischen und politischen Gleichrangigkeit der beiden deutschen Staaten auf, die zu friedlicher Koexistenz und gegenseitiger Anerkennung geführt hätten [...]. Die Rückbesinnung auf die vermeintlich zu Unrecht verkannten Vorzüge des DDR-Bildungssystems, die hässlichen Gesichtszüge eines aus den Fugen geratenen Weltfi nanzsystems, die rückblickende Vorstellung von einer geordneten DDR-Welt, in der der Mensch keine Ware war und für die Gleichstellung der Frau gesorgt war – solcher Art sind die Anknüpfungspunkte, aus denen das Fortschrittsgedächtnis seine Stabilität gewinnt. In diesem tripolaren Kräftefeld zwischen Diktaturgedächtnis, Arrangementgedächtnis und Fortschrittsgedächtnis wird die DDR-Vergangenheit täglich neu verhandelt. Martin Sabrow, Die DDR erinnern, in: Ders. (Hrsg.), Erinnerungsorte der DDR, München 2009, S. 18 20 1. Arbeiten Sie heraus, welche Themen für das Diktaturgedächtnis, das Arrangementgedächtnis und das Fortschrittsgedächtnis jeweils bedeutsam sind. 2. Diskutieren Sie, welche Akteure jeweils als Vertreter der einen oder anderen Gedächtnisform infrage kommen. 3. Beurteilen Sie, welche der Gedächtnisformen am wirkungsmächtigsten ist und daher am ehesten im kollektiven Gedächtnis der Deutschen überdauern wird. 4. Vergleichen Sie die hier beschriebene Situation mit den beiden deutschen Geschichtskulturen nach 1945. M5 Zwischen Erinnern und Vergessen Der Historiker Konrad Jarausch über die Gründe, warum die Herausbildung einer gemeinsam geteilten Erinnerung an den Umbruch von 1989 noch immer schwer fällt: Trotz der Bedeutung des Herbstes 1989 für die Veränderung von Politik und Lebensläufen scheint die Erinnerung an dessen dramatische Ereignisse in der deutschen Bevölkerung schwach ausgeprägt zu sein. […] Obwohl die Zahl von Memoiren und wissenschaftlichen Werken weiter ansteigt, herrscht ein weitgehendes Desinteresse an der „ostdeutschen Selbstbefreiung“ vor, da manche Beteiligte nicht mehr gerne an ihre damaligen Positionen erinnert werden wollen. Im Gegensatz zu dem medialen Tsunami für das Gedenkjahr 2009 gibt es nur wenige Anzeichen für die Entstehung eines Kollektivgedächtnisses von unten wie z. B. in der Nikolaikirche in Leipzig, die den Sturz der SED-Diktatur und die Vereinigung als „ein Wunder biblischen Ausmaßes“ feiert. 1 teleologisch (griech. telos: Ziel, Zweck): auf Teleologie beruhend; Teleologie: Lehre, dass eine Entwicklung von vorn herein zweckmäßig und zielgerichtet angelegt ist 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 5 10 Nu r z u Pr üf zw ec ke n E g tu m d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
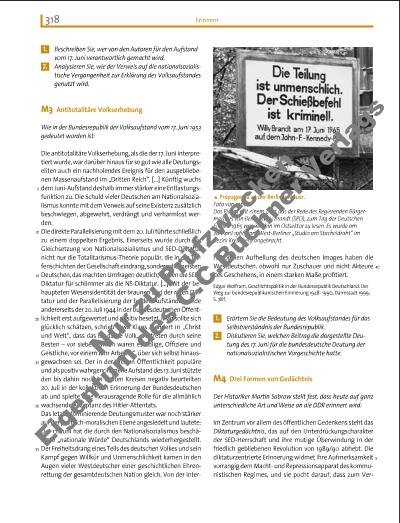 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |