| Volltext anzeigen | |
321Die deutsche Nachkriegsgeschichte im Spiegel der Geschichtskultur 5 10 15 funktion wurde von ostdeutschen Beobachtern bestätigt: Der oppositionelle Schriftsteller Lutz Rathenow wies in seiner Festrede in einer Feier des Thüringischen Landtages am 3. Oktober 2001 auf die zeitliche Nähe des alten Tags der Republik und des Tags der Deutschen Einheit hin und verglich beide Tage. Rathenow erinnerte an den Lärm der Panzer, die ab dem 3. oder 4. Oktober für die Militärparade anlässlich des Tags der Republik probten: „Sie werden verstehen, dass es mir leicht fällt, fast jede musikalische Alternative zu diesem Ton als eine unbestritten bessere anzunehmen.“ Etwas salopper stimmte ihm auch Richard Schröder in einem Fernsehinterview anlässlich des Festakts zum zehnten Jahrestag der Einheit in der Dresdner Semperoper zu, der die Festatmosphäre auf dem Dresdner Theaterplatz mit den Worten lobte: „Auch die Stimmung ist 1a. Wie ich es mir so vorstelle: zivil, locker und trotzdem festlich.“ Vera Caroline Simon, Gefeierte Nation. Erinnerungskultur und Nationalfeiertag in Deutschland und Frankreich seit 1990, Frankfurt am Main u. a. 2010, S. 84 f. 1. Skizzieren Sie, wie in der Bundesrepublik und in der DDR der Nationalfeiertag begangen wurde. 2. Vergleichen Sie die am Staatsfeiertag der Bundesrepublik und der DDR vorgenommenen Rituale mit denen anderer Demokratien und Diktaturen. M7 Eine vergebene Chance? Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler äußert sich zum 9. November als möglichem Nationalfeiertag für Deutschland: Aus der Perspektive der politischen Mythengeschichte Deutschlands […] hätte man damit rechnen dürfen, dass der 9. November 1989 zu einem neuen Gründungsmythos der Deutschen, zumindest aber einem Additionsmythos geworden wäre, der den alten bundesrepublikanischen Gründungsmythos ergänzt: Im Anschluss an eine Pressekonferenz des SED-Politbüromitglieds Günter Schabowski kam es in den Abendstunden zu einem Ansturm der Ost-Berliner auf die Grenzübergänge nach West-Berlin, und innerhalb weniger Stunden brach ein Grenzregime zusammen, das die Welt mehrmals in Atem gehalten und an den Rand eines Krieges gebracht hatte. [...] Am 9. November 1989 wurde in Berlin einmal mehr Weltgeschichte gemacht, dieses Mal jedoch nicht von den Herrschenden, die über das Volk verfügten, sondern von der Bevölkerung selbst, und das in einer kurz zuvor noch unvorstellbaren Form der Selbstermächtigung. Der Stoff, aus dem politische Mythen geformt werden, war somit im Übermaße vorhanden und ebenso die Bilder, die dieser dramatischen Wende Anschaulichkeit verliehen. [...] Was jahrzehntelang Angst und Schrecken verbreitet hatte, wurde zum Schauplatz ausgelassener Feiern. In Berlin kam es zu einem anarchisch-emanzipatorischen Fest, wie es die Deutschen bis dahin nicht gekannt hatten. [...] Die Bilder der Menschen, die sich auf der Mauer, buchstäblich der Trennlinie zwischen Ost und West, die Mitte ihrer Stadt zurückerobert hatten, waren ein politisches Symbol, mit dem sich eigentlich linksliberale wie konservative Kreise identifi zieren konnten: Hier wurden die deutsche Teilung überwunden und die nationale Einheit wiederhergestellt, und erstmals in der deutschen Geschichte nahm eine Revolution einen glücklichen und bis zum Ende erfolgreichen Verlauf. Die damit eröffnete Chance einer gründungsmythischen Neufundierung der Republik ist aus vielerlei Ursachen nicht wahrgenommen worden. [...] Dagegen sprach zunächst das Datum des 9. November, das unerwünschte und politisch gefährliche Erinnerungen an Ereignisse des 20. Jahrhunderts wachrief [...]. Das Problem einer gründungsmythischen Aufbereitung des 9. November 1989 war aber nicht nur das Datum, sondern auch der politisch-geografi sche Raum, der damit herausgehoben worden wäre: Das Gründungsgeschehen der neuen und größeren Bundesrepublik hätte sich dann ausnahmslos auf dem Territorium der DDR abgespielt, und der Deutsche Bundestag in Bonn hätte lediglich insofern mitgewirkt, als sich die Abgeordneten, als die ersten Nachrichten aus Berlin eintrafen, von ihren Stühlen erhoben und die dritte Strophe des Deutschlandlieds sangen. Die westdeutsche Bevölkerung war am 9. November bloß Zuschauer eines Geschehens, zu dem sie nichts beitragen konnte. Die bundesdeutsche Politik kam erst anschließend ins Spiel, wobei sie in innerdeutschen wie internationalen Verhandlungen Einfl uss auf einen politischen Prozess gewann und diesen schließlich zu kontrollieren und zu steuern vermochte, sodass er am 3. Oktober 1990 mit der Zeremonie vor dem Reichstag erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009, S. 477 479 1. Erörtern Sie, warum der 9. November nach Münkler nicht zum Nationalfeiertag der Deutschen werden konnte. 2. Erläutern Sie, welche Qualitäten ein Ereignis haben muss, um „mythentauglich“ zu sein. 3. Diskutieren Sie, ob der 9. November der „bessere Nationalfeiertag“ für Deutschland wäre. Was spräche dafür, was dagegen? 20 25 30 35 40 45 50 25 30 35 N r z u Pr üf zw ck en Ei ge nt um d e C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 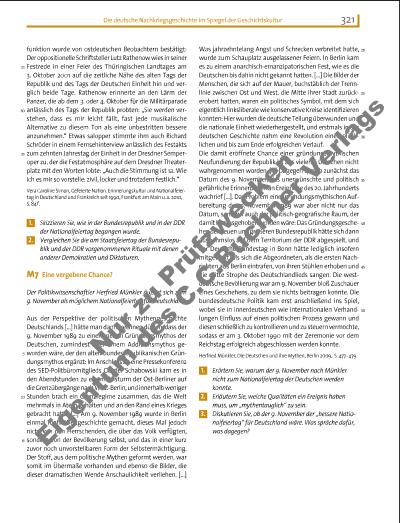 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |