| Volltext anzeigen | |
Der steigende Bedarf an qualifi zierten Arbeitskräften ließ eine neue Berufsgruppe entstehen: die Angestellten. Diese heterogene Gruppe umfasste neben den Büroberufen, den kaufmännischen Mitarbeitern, Buchhaltern, Kassierern oder Schreibkräften, ebenso die Betriebsberufe der Techniker und Ingenieure sowie den Werkstattbereich (Werkmeister u. a.). Auch der um die Jahrhundertwende rapide wachsende Dienstleistungssektor bot den Angestellten in Handel, Banken und Versicherungen viele neue Arbeitsund Aufstiegsmöglichkeiten. In ihrer Lebensführung suchten sich die Angestellten deutlich von den Arbeitern abzugrenzen und näherten sich als „neuer Mittelstand“ dem Bürgertum an. Sichtbarer Ausdruck dafür war eine Reihe von Statussymbolen. Dazu gehörten etwa die standesgemäße Kleidung mit Anzug, weißem Hemd und typischem Stehkragen für die Männer sowie – vor allem nach dem Ersten Weltkrieg – modische Kleidung, Frisuren und Kosmetik für die Frauen. Arbeit in Fabriken und an Maschinen Für die Menschen, die in die Indus triegebiete zogen, veränderten sich Arbeit und Alltag grundlegend. Zwischen 1882 und 1907 verdoppelte sich die Industriearbeiterschaft und wurde bis zum Ersten Weltkrieg zur größten sozialen Gruppe. Fabrikarbeit bedeutete ein durch Arbeitsvertrag und Lohnarbeit gekennzeichnetes Abhängigkeitsverhältnis. Für Selbstbestimmung, individuelle Bedürfnisse oder persönliche Identifi kation mit der Arbeit blieb kein Platz. Stechuhren, disziplinierende Vorarbeiter und stichprobenartige Kontrollen verzeichneten jeden Verstoß gegen die strengen Fabrikordnungen und das kalkulierte Arbeitssoll. Eine besonders effektive und zeitsparende technische Neuerung war die Einführung des Fließbandes, das die schnelle Massenfertigung von normierten Einzelteilen in großen Stückzahlen ermöglichte. Dabei wurde die Produktion in unzählige kleine Zwischenstationen zerlegt, bei der die einzelnen Teile die Fertigung möglichst ohne Unterbrechung durchliefen. Jeder Arbeiter und jede Arbeiterin hatte dabei jeweils nur wenige bestimmte und immer gleiche Handgriffe auszuführen. Die Folge davon war ein steigender Anteil von Anund Ungelernten innerhalb der Indus triearbeiterschaft. 1913 setzte der amerikanische Unternehmer Henry Ford das Fließband erstmals in der Automobilindustrie ein. Die neue Fertigungsmethode ermöglichte es ihm, seinen Arbeitern relativ hohe Löhne auszuzahlen und seine Automobile zu enorm niedrigen Preisen anzubieten. Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde auch in Deutschland auf Fließbandproduktion umgestellt: 1924 eröffnete Henry Ford ein Autowerk in Berlin, im selben Jahr wurde das Fließband bei Opel, 1925 bei Siemens eingeführt. Die standardisierte Arbeit am Fließband ist eng mit den arbeitsund betriebswissenschaftlichen Überlegungen des Amerikaners Frederick W. Taylor verbunden, die nach ihm als Taylorismus benannt sind. Seine umfassende praktische Umsetzung fand der Taylorismus in den Ford-Werken. Die konsequente Rationalisierung durch Fließbandproduktion, Schichtbetrieb und Akkordarbeit galt als nachahmenswertes Erfolgsmodell. Allerdings fand der Tay lorismus nicht nur Anerkennung. Die stereotype, monotone Tätigkeit sowie die durch das Fließband und den Takt der Maschinen gesteigerte Arbeitsgeschwindigkeit wurden als unmenschliche „Arbeitshetze“ heftig kritisiert. Erschwert wurde das hohe Arbeitspensum durch die körperlichen Beeinträchtigungen wie Lärm, Hitze, Schmutz, Gestank, Lichtund Luftmangel. Fehlende Sicherheitsvorkehrungen an den Maschinen verursachten immer wieder schwere Unfälle. Hinzu kamen Berufskrankheiten. Frederick Winslow Taylor (1856 1915): amerikanischer Ingenieur, der als Erster begann, Arbeitsabläufe in Fabriken wissenschaftlich zu analysieren und zu optimieren. Damit gilt er als Begründer der wissenschaftlichen Betriebsführung (Scientifi c Management oder Taylorismus). Literaturtipp: Jürgen Kocka, Geschichte des Kapitalismus, München 22014 22 Die „Zweite Industrielle Revolution“ und die Entstehung der modernen Massengesellschaft i Uhr, Signaltafel, Spinde und Stechuhr: Maßnahmen zur Disziplinierung der Arbeiter. Holzstich aus der „Illustrirten Zeitung“ vom 18. Mai 1889. 4677_1_1_2015_010-047_Kap1.indd 22 17.07.15 11:36 Nu r z u Pr üf zw ec ke n E g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
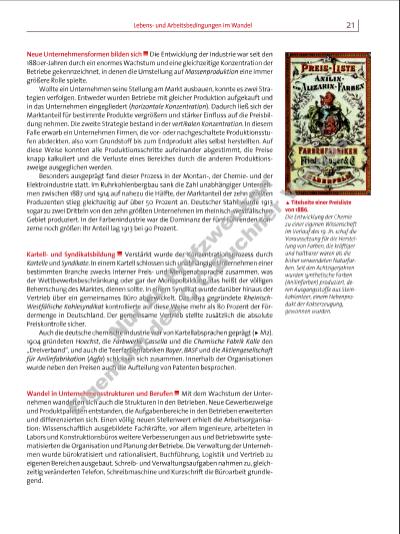 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |