| Volltext anzeigen | |
31510.6 Vertiefung: Kann die Individualisierungsthese den sozialen Wandel erklären? M30 Die Individualisierungsthese von Ulrich Beck 10.6 Vertiefung: Kann die Individualisierungsthese den sozialen Wandel erklären? 45 50 55 60 65 70 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 Der bekannteste deutsche Soziologe Ulrich Beck wurde mit seinem Werk „Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ (1986) berühmt, worin er sich mit dem Grundlagenwandel moderner Gesellschaften befasste. Zwanzig Jahre später erneuerte und erweiterte er seine Zeitdiagnostik in „Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit“ (2007) im Zeichen von Terrorismus, Klimakatastrophen und Finanzkrisen. Seine Theorie der „Individualisierung“ gilt als eine der wichtigsten Erklärungsansätze des gesellschaftlichen Wandels. [Beck spricht von] einer dreifachen „Individualisierung“: Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditionaler Herrschaftsund Versorgungszusammenhängen („Freisetzungsdimension“), Verlust von traditionalen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen („Entzauberungsdimension“) und womit die Bedeutung des Begriffes gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird eine neue Art der sozialen Einbindung („Kontrollbzw. Reintegrationsdimension“). […] Zwei Kristallisationspunkte für Freisetzungen […] zeichnen sich […] ab […]. Zunächst ging es um die Herauslösung aus ständisch geprägten sozialen Klassen, die sich weit zurückverfolgen lässt bis zum Beginn [des 20.] Jahrhunderts, aber in der Bundesrepublik eine neue Qualität gewinnt. […] Ein zweiter Kristallisationspunkt liegt in den Veränderungen der Lage der Frauen. Die Frauen werden aus der Eheversorgung – dem materiellen Eckpfeiler der traditionalen Hausfrauenexistenz – freigesetzt. Damit gerät das gesamte familiale Bindungsund Versorgungsgefüge unter Individualisierungsdruck. Es bildet sich der Typus der Verhandlungsfamilie auf Zeit heraus, in der die bildungs-, arbeitsmarkt und berufsorientierten Individuallagen, soweit sie nicht von vornherein außerfamiliale Lebensformen vorziehen, ein eigenartig widerspruchsvolles Zweckbündnis zum geregelten Emotionalitätsaustausch auf Widerruf eingehen. Neben sozialen Klassenkulturen und dem familialen Beziehungsgefüge gibt es zwei Kristallisationspunkte für Freisetzungen. Sie haben ihren Ausgangspunkt nicht mehr in der Reproduktions-, sondern in der Produktionssphäre und vollziehen sich als Freisetzungen relativ zum Beruf und zum Betrieb. Gemeint sind insbesondere die Flexibilisierung der Erwerbsarbeitszeit und die Dezentralisierung des Arbeitsortes. […] Nun zu der weiterführenden Frage: Welcher Modus der Re-Integration und Kontrolle ist mit den entstehenden Individuallagen verbunden? […] Eine wesentliche Besonderheit des Individualisierungsschubs in der Bundesrepublik liegt in seinen Konsequenzen. […] Die Familie als „vorletzte“ Synthesegenerationsund geschlechtsübergreifender Lebenslagen und Lebensverläufe zerbricht, und die Individuen werden innerhalb und außerhalb der Familie zum Akteur ihrer marktvermittelten Existenzsicherung und ihrer Biografieplanung und -organisation. Diese Ausdifferenzierung von „Individuallagen“ geht aber gleichzeitig mit einer hochgradigen Standardisierung einher. […] Die freigesetzten Individuen werden arbeitsmarktabhängig und deshalb bildungsabhängig, konsumabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten, Möglichkeiten und Moden in der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Beratung und Betreuung. […] Freisetzungsdimension Dimensionen der Individualisierung Entzauberungsdimension Kontroll und Reintegrationsdimension Individualisierung Der deutsche Soziologe Ulrich Beck (* 15.5.1944 † 1.1.2015) untersuchte vor allem den gesellschaftlichen Wandel der Moderne. Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
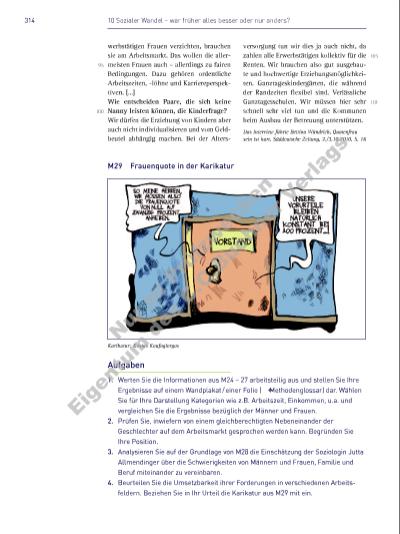 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |