| Volltext anzeigen | |
35512.1 Sozialstaat, verfassungsrechtliche Grundlagen des Sozialstaates 5 10 15 20 25 30 c) Die Folgen der Wiedervereinigung und die Strukturreform der rot-grünen Koalition (Agenda 2010) Mit der deutschen Einheit im Jahre 1990 sind, abgesehen von einigen Übergangsregelungen, die sozialpolitischen Institutionen des Westens weitgehend unverändert in den neuen Bundesländern übernommen worden, was einen radikalen Bruch mit dem Sozialsystem der DDR bedeutete, das durch Zentralismus und Egalisierung auf niedrigem Niveau gekennzeichnet war. Damit stiegen auf allen Feldern der Sozialpolitik die vereinigungsbedingten Ausgaben an, die größtenteils durch die Sozialversicherungen finanziert wurden. Zudem schwächte sich das Wirtschaftswachstum Mitte der 90er-Jahre deutlich ab, was die Arbeitslosigkeit wieder ansteigen ließ. Eine neue Herausforderung des Wohlfahrtsstaates bildete zunehmend auch der demografische Wandel. All dies erforderte Maßnahmen in verschiedenen Leistungsbereichen, die in verschiedenen Gesetzen verabschiedet wurden. Vielfach beinhalten diese eine Erhöhung der Beiträge und eine Kürzung der Leistungen, die oft hinter „technischen“ (wie demografischer Faktor) und neutralen Begriffen (wie Gesundheitsstrukturgesetz, das 1992 eine Budgetierung der Gesundheitsleistungen mit sich brachte […]). […] Doch erst die rot-grüne Koalition hat nach 1998 erhebliche Reformschritte mit strukturveränderndem Charakter eingeleitet. Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Einführung der Riester-Rente als kapitalgedeckte, privat organisierte Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung sowie die Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt. Mit letzteren wurden zum einen ein Umbau der Organisation der Arbeitsverwaltung und ein Schritt in die Richtung der Aktivierung (nach Motto: Fördern und Fordern) vollzogen; zum anderen wurde mit dem ALG II (dem sogenannten Hartz IV-Geld) die Leistung für Arbeitslose, die länger als ein Jahr erwerbslos sind, vom vorherigen Einkommen abgekoppelt und damit eine deutliche Abkehr vom traditionellen Sozialversicherungsprinzip vollzogen. […] Die schrittweise Einführung der Rente mit 67 durch die anschließend regierende große Koalition ist zwar vor allem eine Konsequenz des demografischen Wandels, stellt aber ebenfalls – zumindest in den Augen der Bevölkerung – einen Bruch mit den institutionellen Strukturen des deutschen Sozialstaates dar. Vor allem, wenn sich die bisherigen Beschäftigungsmuster und Präferenzen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht ändern, drohen ein erheblicher Rückgang der Rentenhöhen und eine Gefahr der Altersarmut für die heutigen Beitragszahler. Josef Schmid, Sozialstaat. Eine Institution im Umbruch, in: Stefan Hradil (Hg.), Deutsche Verhältnisse, Eine Sozialkunde, Frankfurt 2013, S. 427 f. Kapiteldeckungs verfahren Das Kapitaldeckungsverfahren trifft im Wesentlichen auf die Rentenversicherung zu. In diesem Verfahren spart jeder für sich selbst an. Dies geschieht z.B. durch eine „normale“ Geldanlage, Fonds, private Lebens oder Rentenversicherungen oder betriebliche Altersversorgung. Im Rentenalter wird das angesparte Kapital sukzessive abgebaut. Mit anderen Worten: Die Rente ist durch das (angesparte) Kapital „gedeckt“. Die Riester-Rente [W]ährend der Reform der gesetzlichen Rentenversicherungen in den Jahren 2000 und 2001 [wurde] eine neue Zusatzrentenform geschaffen, die nach dem damaligen Arbeitsminister Riester benannt wurde: […] Der Versicherungsnehmer muss bei der freiwilligen Riester-Rente jährlich einen Mindestbeitrag in die Versicherung einzahlen, der abhängig vom vorjährigen sozialversicherungspfl ichtigen Einkommen ist. […] Abhängig vom eigenen Status […] fördert der Staat den eingezahlten Betrag mit einer so genannten Altersvorsorgezulage […]. Mit Erreichen des Rentenalters wird das angesparte Geld dann als monatliche – in weiten Teilen jedoch steuerpfl ichtige – Leibrente ausgezahlt. © Versicherungen-Defi nitionen, Die Riester-Rente, www.versicherungendefi nitionen.de, Abruf am 24.6.2015 Die Maßnahmen der Agenda 2010 Arbeitsmarkt: Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wurde gekürzt, die Unterstützung für Langzeitarbeitslose auf das Niveau der Sozialhilfe gesenkt. Dazu wurden Arbeitslosenund Sozialhilfe zum neuen Arbeitslosengeld II zusammengelegt. Durch die HartzIV-Reform stieg für Erwerbslose der Druck, gering bezahlte Beschäftigung anzunehmen. Deutschland erhielt damit den größten Niedriglohnsektor Europas. Erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger wurden unter dem Motto „Fördern und Fordern“ aber erstmals in die Jobvermittlung einbezogen. Zeitund Leiharbeit wurden liberalisiert, Kleinbetrieben Kündigungen von Mitarbeitern erleichtert. […] Inzwischen wurde für Ältere die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I wieder verlängert – von 18 auf 24 Monate. Für die Bezieher von Hartz IV wurden die Hinzuverdienstmöglichkeiten – auch die ihrer Kinder – nachgebessert, ebenso das Schonvermögen aus angesparter Altersvorsorge. Clemens Schömann-Fink, Schröders Prestigeprojekt feiert Jubiläum. Die (Miss-)Erfolge bei Rente und Gesundheitspolitik, www.focus.de, 13.3.2013 5 10 Nu r z u Pr üf zw ck en Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la s | |
 « | 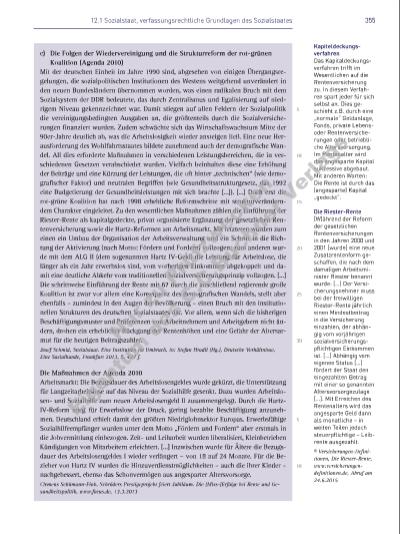 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |