| Volltext anzeigen | |
Grundlagen: Baustein 1: Erklärungsansätze internationaler Handelsbeziehungen 155 für beide selbst dann, wenn ein Land alle Güter günstiger herstellen kann als das andere. Ricardo erklärte seine Theorie am Beispiel der Handelsnationen England und Portugal und der beiden Allerweltsgüter Tuch und Wein. Er geht von der stark vereinfachten Vorstellung aus, dass beide jeweils nur ein Gut liefern: Das industrialisierte England bezieht Wein aus dem Agrarland Portugal und exportiert seine Stoffe dorthin. Dieser Handel ist für beide Länder von Nutzen, sagt Ricardo, obwohl Portugal beide Güter (in Arbeitszeit gemessen) zu niedrigeren Stückkosten herstellen kann als England. Die Portugiesen sind jedoch im Vergleich zu den Engländern bei der Weinerzeugung noch deutlich produktiver als bei der Tuchherstellung – deshalb liegt der komparative Kostenvorteil Portugals bei Wein. Für das Land lohnt es sich daher, sich auf die Weinerzeugung zu konzentrieren und das Tuch nicht mehr selbst zu weben, sondern im Handel mit England gegen Wein einzutauschen – denn die Portugiesen brauchen weniger Arbeit, die für den Export benötigte Menge Wein zu erzeugen, als sie einsetzen müssten, wenn sie das Tuch für den Eigenbedarf selbst fertigten. Spiegelbildlich haben die Engländer einen komparativen Kostenvorteil bei Tuchen: Ihr Arbeitseinsatz, das für den Tausch benötigte Tuch herzustellen, ist geringer als beim Anbau eigenen Weins. Die eingesparten Arbeitskräfte kann England dann profitabler in anderen Industriezweigen einsetzen. Ricardos Fazit: Wenn sich jedes Land auf das Produkt konzentriert, das es, relativ gesehen, billiger produzieren kann, wächst in beiden Ländern der Wohlstand. Bei aller Theorie blieb Ricardo dennoch Geschäftsmann und wusste, dass sich Kaufleute nicht um so etwas Abstraktes wie komparative Kosten kümmern. Für sie zählen allein die Preise. Aber auch dann hält er seine Theorie für zutreffend, wie er wiederum am Beispiel Englands und Portugals erklärt: Englische Kaufleute neigen sehr wahrscheinlich dazu, auch Tuche aus Portugal zu importieren, wenn sie dort preiswerter sind als in England. Damit bringen sie jedoch gleichzeitig Geld nach Portugal. Die so höhere Geldmenge führt dort zu Inflation, also zu höheren Preisen, während die englischen Preise wegen der abnehmenden Geldmenge fallen [vgl. S. 100]. Diese Geldströme dauern so lange an, bis es wieder vorteilhaft ist, Stoffe von England nach Portugal zu exportieren. Mit einiger Verzögerung bestimmen also auch in diesem Fall die komparativen Kostenvorteile den Warenaustausch. […] (Ruprecht Hammerschmidt/Katharina Kort: Lohnender Tausch, David Ricardo über die Grundsätze der Politischen Ökonomie und Besteuerung, in: DIE ZEIT Nr. 23/1999) Vergleichen Sie die Handelstheorien von A. Smith und D. Ricardo miteinander. Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede lassen sich erkennen? Weisen Sie anhand der Beispiele auf S. 156 die theoretischen Annahmen hinsichtlich der absoluten und komparativen Kostenvorteile rechnerisch nach (Lösungshinweise finden sich unter www.dialog-sowi.de). 1 2 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
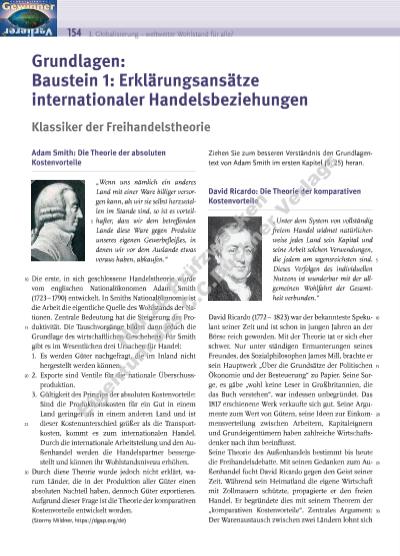 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |