| Volltext anzeigen | |
7So findet ihr euch im Buch zurecht Teilkapitel – das Wichtige, übersichtlich geordnet Auf der linken Seite haben die Verfasser aufgeschrieben, was sie für wichtig halten. Hier erfahrt ihr das Wesentliche zum Thema. Das euch schon bekannte Symbol oben zeigt, welche Kategorie vor allem behandelt wird. Neue Lernbegriffe werden fett gedruckt und unten wiederholt. Außerdem enthält das Buch viele Materialien. Diese Texte, Bilder und Zeichnungen sind mit gekennzeichnet und nummeriert. Mit ihnen könnt ihr eigenständig arbeiten. Die Zeitleiste enthält die Daten der Doppelseite – findet mit der Fragen an ... Seite heraus, welche Zeit ihr gerade bearbeitet. Arbeitsvorschläge stehen unten rechts. Zu kniffligen Fragen geben wir Hilfen. Methoden – Aufgaben schrittweise lösen Wer die Geschichte verstehen will, muss die richtigen Fragen stellen und zu ihrer Beantwortung schrittweise vorgehen. Dafür braucht ihr Methoden. Wir zeigen euch an Beispielen, wie ihr Material auswertet. Auf den Methodenseiten könnt ihr das gleich selbst erproben: 1 bearbeiten wir mit euch gemeinsam. Jetzt bist du dran: Zu 2 machen wir keine Vorschläge. Mit den Hilfen zur Formulierung könnt ihr diese und kommende Aufgaben sicher allein lösen! „Das weiß ich, das kann ich!“ – Testet euch selbst Am Ende des Kapitels seid ihr Experten für die behandelte Zeit! „Das weiß ich – das kann ich!“ kommt auf die Leitfrage von der „Fragen an ...“-Seite zurück: Links machen wir Vorschläge, wie ihr die Fragen zu den Kategorien beantworten könntet. Rechts findet ihr neues Material und passende Aufgaben. Damit könnt ihr prüfen, wie gut ihr euch jetzt auskennt und wie sicher ihr die Methoden anwenden könnt. Noch unsicher? Besucht im Internet die Seite Kompetenz-Test! Hier könnt ihr checken, was ihr schon gut erklären könnt und was ihr noch üben solltet. 6 162 Krieg der Bilder Im Ersten Weltkrieg wurde erstmals Propaganda eingesetzt, um Einfluss auf die Einstellung der Bevölkerung zu nehmen. Postkarten waren als Massenmedium besonders geeignet, den Kampfgeist anzuspornen, die Vaterlandsliebe zu betonen oder den Durchhaltewillen zu fördern. Mit ihnen konnten die Gefühle der Menschen angesprochen werden: Postkarten waren durch die persönlichen Nachrichten ein sehr individuelles Medium, zudem sorgten sie für eine qualitativ hochwertige, bis dahin unbekannte Bilderflut. So verwundert es nicht, dass während des Ersten Weltkrieges Milliarden kostenlos verteilte Postkarten zwischen Heimat und Front verschickt wurden. Um Propaganda zu erkennen und zu entschlüsseln, kannst du nach folgendem Schema vorgehen: 1.Bildbeschreibung Personen, Gegenstände, Landschaft, Symbole, Farben… Was fällt dem Betrachter besonders auf? Was ist im Vorder-/Hintergrund zu sehen? Aus welcher Perspektive blickt man auf das Geschehen? Wie sind die Personen dargestellt? Wie sind die Bewegungs-/Blickrichtungen? Welche Details lassen sich erkennen? Was sticht besonders hervor? Welche Elemente, die man erwarten könnte, fehlen bei der Darstellung? 2. Textbetrachtung Inhalt, Adressat, Sprache, Bezug zum Bild... Wie ergänzt / erklärt der Text das Bild? Wer spricht / schreibt ihn? Wer wird angesprochen? Welche sprachliche Form hat der Text? 3. Entschlüsselung Deutung, Erschließung der Gefühle, historische Hintergründe... Welche Emotionen löst das Bild / der Text aus? Ist die Szene natürlich oder gestellt? Welche Bedeutung haben die Farben / Gegenstände? Welche Rolle spielt das Licht? Welche Atmosphäre wird vermittelt? Inwiefern wird der Betrachter einbezogen? Auf welche Ereignisse bezieht sich die Postkarte? 4. Bewertung Vergleich mit der historischen Realität, Wirkung, Handlungsaufforderung… Welche Haltung wird beim Betrachter erzeugt? Wo unterscheiden sich Postkarte und Realität? Wie wird die Realität verfälscht? 1 Soldaten verschiedenen Alters, Frauen und Kinder 4 unter belgischen Opfern auch Frauen und Kinder 4 Aussagen der Entente-Mächte sollen unglaubwürdig gemacht werden 4 weite Teile Belgiens wurden zerstört 2 Bezug zwischen Text und Bild: Widerspruch 1 fürsorgliche Soldaten in sauberen Uniformen 2 Begriffsklärung „Barbaren“: in diesem Zusammenhang rohe, unzivilisierte, brutale Menschen 2 Begriffsklärung „Feindesland“: Land eines Kriegsgegners 3 Identifikationsmöglichkeiten: Söhne, Väter, Brüder 1a Historischer Kontext Diese Zusatzinformationen benötigst du, um die Propaganda-Postkarte M1 b zu entschlüsseln: 1c Propaganda entschlüsselt! Mit den Arbeitsschritten und den Informationen aus M1 a könntest du die Postkarte M1 b etwa so entschlüsseln: Die deutsche Postkarte von 1915 ist ein gestelltes Foto: Vier Soldaten machen Pause unter freiem Himmel. Sie sind fröhlich, ihre Gewehre haben sie abgestellt. Eine Frau und zwei kleine Kinder sind hinzugekommen. Ein Mädchen streichelt einem der Soldaten die Wange, ein anderer scheint dem Jungen etwas zu schenken Der Titel „Deutsche Barbaren“ steht in Anführungsstrichen. Seit Kriegsbeginn wurden Deutschland von seinen Gegnern barbarische Verbrechen und eine grausame Kriegsführung vorgeworfen. Besonders der Marsch durch das neutrale Belgien und Übergriffe auf Zivilisten wurden angeprangert und gegen Deutschland gerichtet. Die Postkarte gibt mit der Bildunterschrift vor, die „Wahrheit“ über das Verhalten deutscher Soldaten in besetzten Gebieten zu zeigen: Sie seien friedlich, kulturvoll und so harmlos, dass Frauen und Kinder sich ihnen vertrauensvoll nähern und sogar beschenken lassen. Die Postkarte vermittelt deutschen Soldaten, dass sie einer ehrenvollen, sogar vom Feind respektierten Armee angehören. Besonders richtet sie sich aber an deutsche Zivilisten, um die Wirkung der Anklagen gegen Deutschland zu entkräften. Dies soll den Glauben an den Sinn des Krieges und die Opferbereitschaft fördern. Beitrag von Andrea Köhler für diesen Band. 5 10 15 20 163 Methode: Fotos als Instrumente der Kriegspropaganda 3 familiärer Eindruck 3 „Feindesland“ im historischen Bezug: Einmarsch in Belgien, Schlieffenplan 3 „Barbaren“: Vorwurf der EntenteMächte gegen Deutschland 1 Die Kinder vertrauen den Soldaten 1 Waffen stehen unbenutzt 1 Idylle, Ruhe, unzerstörte Landschaft 3 Betonung der Freundlichkeit der deutschen Soldaten 1 Kaffeepause 1b „Deutsche Barbaren“ Deutsche Postkarte aus dem Jahr 1915 2 „Die Sonne sank im Westen“ Deutsche Postkarte aus dem Jahr 1915 1. Schreibe eine Analyse der Propagandapostkarte M2. Orientiere dich am Schema links. 2. Erkläre mit Hilfe der Definition rechts, warum es sich bei M2 um Propaganda handelt. 3. Finde Gemeinsamkeiten von M1 und M2. Leite daraus allgemeine Regeln für die Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg ab. 4. Verfasse die Reaktion eines Frontsoldaten, der die Postkarte M1 oder m2 sieht. Propaganda (von lat. propagare: erweitern, verbreiten): Die gezielte, systematische Verbreitung von politischen Ideen, Weltanschauungen oder Meinungen. Bei politischer Propaganda geht es auch um die Manipulation von Meinungen und Einstellungen. Deshalb hat der Begriff Propaganda einen deutlich negativen Beigeschmack und wird häufig mit Diktaturen in Verbindung gebracht. Meth de: Propagandapostkarten entschlüsseln 138 139 6 Europäer errichten Kolonien Seit dem 15. Jh. befuhren europäische Seefahrer die Weltmeere. Sie nahmen Gebiete in Übersee im Namen ihrer Herrscher in Besitz und machten sie zu Kolonien. Besonders die Portugiesen und Spanier taten sich bei der Entdeckung neuer Seewege und Landteile hervor. Sie waren die ersten, die Kolonien in Mittelund Südamerika bzw. an den Küsten Afrikas und Asiens errichteten. Später folgten Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Russland als weitere Kolonialmächte. Das Zusammentreffen mit den Einheimischen wurde je nach Situation als Kulturbegegnung oder -zusammenstoß wahrgenommen. Vom Kolonialismus… Die Kolonialmächte wollten ihre Handelswege ausdehnen, neue Handelsstützpunkte errichten und vor allem mit exotischen Produkten wie Elfenbein, Gewürzen und Seide reicher werden. Oft finanzierten Handelsgesellschaften die Entdeckungsfahrten, um später höhere Gewinne erzielen zu können. Sogar aus dem Handel mit Menschen wurde ein Geschäft gemacht, indem beispielsweise Millionen Afrikaner als Sklaven verschleppt wurden. Die Welt wird aufgeteilt Trotzdem sahen sich die Europäer als gute Christen an. Sie hielten ihre Kultur und ihren christlichen Glauben für überlegen und wollten die Einheimischen, zur Not auch unter Zwang, durch Missionierung zum Christentum bekehren. … zum Imperialismus Im letzten Viertel des 19. Jh. steigerte sich der Kolonialismus zum Imperialismus. Die europäischen Nationen sowie die USA und Japan versuchten, ihren Machtund Einflussbereich möglichst weit auszudehnen. Die Industriestaaten strebten nach einem möglichst großen Herrschaftsraum (lat. imperium), um so ihren wirtschaftlichen Anteil am Weltmarkt auszubauen. Die Kolonien sollten dabei gleichzeitig billige Rohstoffe liefern und als neue Absatzmärkte dienen. Daneben wollten die Kolonialstaaten aber auch ihr Ansehen steigern und neue Militärstützpunkte schaffen. Um ihre Interessen gegenüber den Kolonialvölkern durchzusetzen, nutzten die Kolonialmächte zwei verschiedene Herrschaftsformen: t EJFformelle Herrschaft: Die Kolonialmächte übernehmen die direkte Herrschaft. Sie bauen eine eigene Verwaltung auf und kontrollieren das Gebiet mit Hilfe von Militär und Polizei. t EJFinformelle (indirekte) Herrschaft: Um möglichst wenig finanziellen Aufwand zu haben, lassen die Kolonialmächte einheimische Machthaber im Amt und zwingen sie, so zu regieren, wie es für die jeweilige Kolonialmacht nützlich ist. Die Kolonialmächte hatten während der Industrialisierung technische Fortschritte gemacht. Sie konnten die Kolonialgebiete mit Telegrafie, Dampfschiffen, Eisenbahnen und modernen Waffen kontrollieren, effektiv verwalten und große Warenmengen schnell über weite Strecken transportieren. Die Einheimischen waren ihnen militärisch als auch wirtschaftlich unterlegen. 1. Beschreibe die Karte (M2). Erläutere, wie das Zusammenleben im britischen Empire charakterisiert wird. 2. Fasse anhand von M3 und M4 in einer Tabelle die Motive für den Erwerb von Kolonien zusammen. 3. Arbeite aus M3 und M4 heraus, wie die Kolonialherren über die einheimische Bevölkerung in den Kolonien dachte. 4. Vergleiche deine Ergebnisse aus den Aufgaben 1 bis 3 miteinander. Passen die Einstellungen, die in den Materialien deutlich werden, zueinander? 1 Verachtet sei, wer Schlechtes dabei denkt Französische Zeichnung von 1899 Der Titel ist die Übersetzung des Schriftzuges. Er ist das Motto der höchsten englischen Auszeichnung, des „Hosenbandordens“, und der Wahlspruch auf dem Wappen der englischen Monarchen. Beschreibe die Zeichnung und überlege, warum der französische Zeichner sie mit dem Wahlspruch in Verbindung gebracht hat. Formuliere auf der Basis deiner Ergebnisse einen neuen Titel. Missionierung Kolonialismus Imperialismus formelle/informelle Herrschaft 3 Die erste Rasse in der Welt Der britische Kolonialpolitiker Cecil Rhodes rechtfertigt 1877 den Erwerb von Kolonien: Ich behaupte, dass wir die erste Rasse in der Welt sind und dass es für die Menschheit umso besser ist, je größere Teile der Welt wir bewohnen. […] Darüber hinaus bedeutet es einfach das Ende aller Kriege, wenn der größere Teil der Welt in unserer Herrschaft aufgeht. […] Da [Gott] sich die englischsprachige Rasse offensichtlich zu seinem auserwählten Werkzeug geformt hat, durch welches er einen auf Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden gegründeten Zustand der Gesellschaft hervorbringen will, muss es auch seinem Wunsch entsprechen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um jener Rasse so viel Spielraum und Macht wie möglich zu verschaffen: nämlich so viel von der Karte Afrikas britisch rot zu malen wie möglich […]. Nach: Wolfgang J. Mommsen (Hrsg.), Imperialismus. Seine geistigen, politischen und wirtschaftlichen Grundlagen. Ein Quellenund Arbeitsbuch, Hamburg 1977, S. 103 f. 5 10 15 5 1. Unterscheide zwischen Kolonialismus und Imperialismus. 2. Erkläre den Unterschied zwischen formeller und informeller Herrschaft. 2 „Imperial Federation Map of the World“ Beilage der Zeitung „The Graphic“ vom 24. Juli 1886 Die Karte zeigt das britische Weltreich (Empire) mit seinen Gebieten (rot) und den Schifffahrtslinien, den Gebietsgewinnen seit 1786 (kleine Karte) und Statistiken zu Geografie, Bevölkerung und Handel. 4 Viele neue Frankreiche Der französische Außenminister Gabriel Hanotaux sagt 1901: Bei der Ausdehnung Frankreichs handelt es sich nicht um Eroberungs oder Machtpolitik, sondern darum, jenseits der Meere in Landstrichen, die gestern barbarisch waren, die Prinzipien der Zivilisation zu verbreiten […]. Es handelt sich darum, in der Nähe und in der Ferne ebenso viele neue Frankreiche zu schaffen. Es handelt sich darum, unsere Sprache, unsere Sitten, unser Ideal […] inmitten der stürmischen Konkurrenz der anderen Rasse […] zu schützen. Die französische Ausbreitung hatte zu allen Zeiten zivilisatorischen und religiös-missionarischen Charakter. Nach: Karl Epting, Das französische Sendungsbewusstsein im 19. und 20. Jahrhundert, Heidelberg 1952, S. 90 34 1 35 Das weiß ich – das kann ich! Der frühneuzeitliche Fürstenstaat Wirtschaft und Umwelt Die absolutistischen Fürsten stellten die Wirtschaft in ihre Dienste. Vor allem Herrschaft und Hofhaltung Ludwigs XIV. verschlangen Unsummen an Geld, das eine neue Wirtschaftspolitik einspielen sollte: der ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍. Er förderte den Handel und das Gewerbe, etwa durch staatliche ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍, sowie den Export von Fertigwaren ins Ausland. Der Merkantilismus brachte kurzfristige Erfolge, konnte aber langfristig nicht die notwendigen Einnahmen sichern. Herrschaft Seit dem Spätmittelalter waren die Fürsten zu ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ über ihre Herrschaftsgebiete geworden, die sie zu ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ mit eigener Verwaltung ausbauten. Begünstigt wurde dies durch die ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍, als die Fürsten mit den Landeskirchen auch Verwaltung und Kontrolle des Staates ausbauten. Der ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ entstand. Im Gegensatz zu den Monarchien Frankreich, England oder Spanien blieb das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in der Frühen Neuzeit ein lockerer Verbund vieler Einzelstaaten. Fast überall in Europa setzte sich seit dem17. Jh. die Herrschaftsform des ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ durch, eine besondere Form von Monarchie, bei der König oder Fürst seine Macht nicht teilen wollte. Zum Vorbild wurde der französische König Ludwig XIV., der „Sonnenkönig“. Er regierte ohne Adel und ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ und stützte seine Herrschaft auf abhängige Beamte sowie ein stehendes Heer. Außenpolitisch strebte er nach der Vorherrschaft (❍❍❍❍❍❍❍❍❍) in Europa, die vor allem Englands Vorstellung von einem ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ der Mächte entgegenstand. Ausdruck seiner Machtfülle war das prächtige Schloss Versailles. Es war Vorbild für kleine und große Fürsten in ganz Europa, die ebenfalls nach absolutistischer Machtund Prachtentfaltung strebten. Weltdeutung und Religion Der christliche Glaube spaltete sich auf in die römischkatholische und verschiedene evangelische oder reformierte Kirchen. Der „Augsburger Religionsfrieden“ von 1555 bestätigte die Glaubensspaltung, die sich bald auf ganz Europa ausweitete. Die Herrschenden bauten Landeskirchen auf und bestimmten nun den Glauben ihrer Untertanen. Viele Herrscher bekämpften religiöse Minderheiten, um so ihre Herrschaft zu festigen. Dies löste vor allem in England (❍❍❍❍❍❍❍❍❍) und Frankreich (❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍) große Fluchtbewegungen aus. Die Gegensätze der Glaubensrichtungen (Konfessionen), aber auch politisches Machtstreben führten zu (Glaubens-)kriegen in Europa. Der längste und blutigste Konflikt war der Dreißigjährige Krieg. Er fand erst im ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍ 1648 ein Ende. Gesellschaft Auch in der Frühen Neuzeit galt die Ständeordnung. Vor allem das Bürgertum gewann jedoch immer mehr an Einfluss. Durch Bildung und wirtschaftlichen Erfolg gelangten Juristen, Ärzte, Theologen und Kaufleute in städtische Führungsschichten und wurden zu Hofund Staatsbeamten der fürstlichen Landesherren. Verdiente Bürger konnten in den Adelsrang erhoben werden. Auch die Adligen wechselten von ihren Landgütern immer häufiger in den fürstlichen Hofund Staatsdienst. Der ❍❍❍❍❍❍❍❍ ❍❍❍❍❍❍❍❍❍❍ mit festem Zeremoniell wurde zur adligen Leitkultur. So gelang es den absolutistischen Fürsten, den Adel an sich zu binden und ihre Herrschaft zu zentralisieren. Begegnung Die fürstlichen Residenzen zogen Adel, Gelehrte, Künstler und gehobenes Bürgertum aus ganz Europa an und förderten den Austausch. Von Versailles verbreitete sich die französische Hofkultur bis in die kleinsten Residenzstädte: Französische Sprache, Mode, die höfische „❍❍❍❍❍❍❍❍“ mit Essund Trinkkultur, Zeremoniell, Tanz, Literatur und Musik. Etwa 200 000 Hugenotten flohen vor Unterdrückung und Gewalt aus Frankreich. Sie brachten ihre Religion, Lebensweise, Kenntnisse und Fertigkeiten in ihre Aufnahmeorte mit. Am Anfang dieses Kapitels steht die Leitfrage: Was kennzeichnet den frühneuzeitlichen Fürstenstaat? Mit den Arbeitsfragen zu den fünf Kategorien auf Seite 12 / 13 kannst du sie nun beantworten: 1. Die farbig unterlegten Lernbegriffe sind verloren gegangen. Setze die richtigen Begriffe ein und erkläre ihre Bedeutung in eigenen Worten deinem Sitznachbarn. 2. Erarbeite ein Schaubild, in dem du die Verknüpfungen zwischen den Kategorien darstellst. Im Zentrum steht der frühneuzeitliche Fürstenstaat. 1. Erläutere, was Thackeray mit seiner „historischen Studie“ (M1) ausdrücken will. Vergleiche dazu die Zeichnung mit dem Gemälde von Rigaud (siehe S. 24). 2. Suche im Internet nach einem Foto, auf dem ein Staatsoberhaupt oder Regierungschef von heute zu sehen ist. Ludwig XIV. behauptete: „L‘État, c‘est moi!“ „Der Staat bin ich!“ Begründe, welches Motto unter dem Bild des heutigen „Herrschers“ stehen könnte. 3. Du bist der Fürst in einem kleinen norddeutschen Fürstentum. Du willst dein Land nach dem Vorbild des Königreichs Frankreichs Ende des 17. Jh. modernisieren (M2). Wie gehst du vor? Beschreibe deine Schritte. Nenne aber auch mögliche Schwierigkeiten und deren Lösung. 2 Der absolutistische Staat unter Ludwig XIV. Das Schaubild stellt das theoretische Konzept des absolutistischen Staates dar. Ideal und tatsächliche Umsetzung klafften allerdings oftmals weit auseinander. So gab es unter Ludwig XIV. etwa 40 000 Beamte, die ihr Amt meist gekauft hatten und es als reine Einnahmequelle betrachteten. Sie befolgten die Weisungen von oben meist unzureichend. Auch gab es kein einheitliches Modell des absolutistischen Staates. Frankreich galt zwar als Vorbild, jedoch verlief die Entwicklung überall anders. 1 „Eine historische Studie“ Buchtitelblatt zu Titmarsh (dies ist der englische Schriftsteller W. M. Thackeray), The Paris Sketchbook, 1840 W. M. Thackeray schreibt zu seiner „Studie“: „Man sieht sofort, dass die Majestät aus der Perücke gemacht ist, den hochhackigen Schuhen und dem Mantel. So stellen Barbiere und Flickschuster die Götter her, die wir anbeten.“ 1 Die indirekten Steuern waren Verbrauchssteuern. Sie wurden auf Getränke (Wein), Salz, Außenund Binnenzölle erhoben. Darüber hinaus gab es eigene Verbrauchssteuern und Zölle in den Städten. Die indirekten Steuern machten 40 % der französischen Staatseinnahmen aus. Privatgewerbe und staatliche Manufakturen Fertiggüter Luxusgüter sta atl ich e Inv est itio ne n Handel Gewinn Abgaben Adel und Klerus Zölle Importzölle für Fertigund Luxusgüter Binnenhandel, Außenhandel, staatlich geförderte Handelsgesellschaften Landwirtschaft Bauern und Kleinbürger tragen Hauptsteuerlast Grundbesitz, Steuerfreiheit und Sondergerichtsbarkeit Finanzverwaltung Gewinne für Staat und Hof aus Zöllen, Steuern, staatlichen Monopolen (Manufakturen) und Ämterverkauf Kolonien Rohstoffe, Gewürze indirekte Steuern1 direkte undindirekte Steuern1 Rohstofflieferant und Absatzmarkt über Handelsgesellschaften Kabinett mit Ministern als Berater des KönigsMarine und Heer Hohe Kosten durch prunkvolle Bauten und Hofhaltung in Versailles Absolutistischer Herrscher: legitimiert durch Abstammung und Gottesgnadentum Gesetzgeber, Oberhaupt des Staates (Wirtschaft, Militär, Verwaltung, Kultur, öffentliche Einrichtungen) und der Kirche, erhebt Steuern und entscheidet über Krieg und Frieden Hohe Kosten durch den Ausbau der Verwaltung, das stehende Heer und viele Kriege Lebensmittel | |
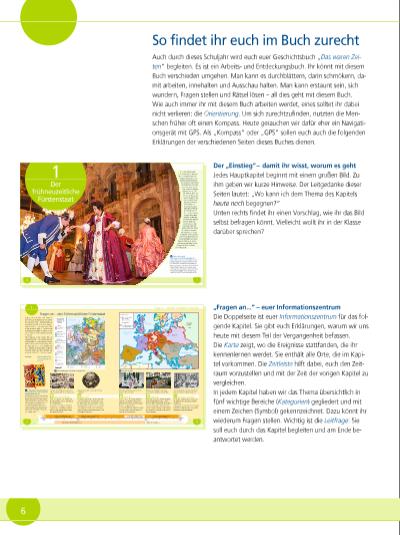 « | 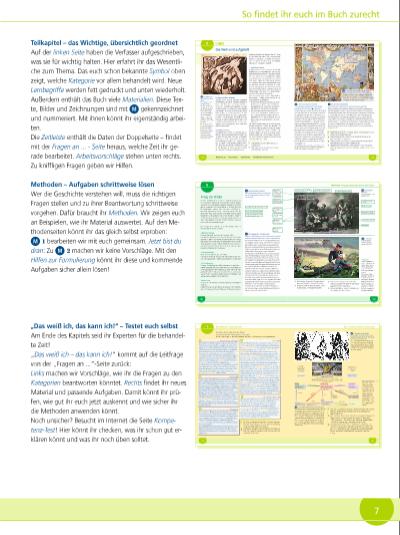 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |