| Volltext anzeigen | |
keinesfalls das Setzen der Regeln selbst. Eine Ordnung, die den Einzelnen weder einer staatlichen Bevormundung unterwirft noch einem Markt, auf dem die Starken so groß werden können, dass sie selbst die Regeln bestimmen, eine Ordnung, die so Euckens Worte auf das Anliegen der sozialen Gerechtigkeit zielte und zur Erfüllung dieses Anliegens auf den höchsten möglichen wirtschaftspolitischen Wirkungsgrad. […] Ich will hier auf die Verdienste, die Details und die Etappen im Einzelnen nicht eingehen. Auf die Chuzpe Erhards etwa, der 1948 die Freigabe der Preise durchsetzte; auf die staunenden Menschen vor den prall gefüllten Schaufenstern am Tag nach der Währungsreform; oder auf den langen Kampf um das Kartellgesetz. Letztlich wirkte die geniale Kompromissformel der sozialen Marktwirtschaft, die Alfred Müller-Armack ersonnen hatte. Sie wirkte. Nicht alles, was blühte im Wirtschaftswunder, war freilich auf ihrem Boden gewachsen. Es gab die Kredite des Marshall-Plans, wir erinnern uns, und es gab auch einen steten Zustrom von Arbeitskräften aus dem Osten. Aber rückblickend können wir sagen, es war nicht nur ein Wirtschaftswunder, sondern es war auch ein Freiheitswunder, was da passierte. Die Deutschen konnten sich, zumindest im Westen, mit Markt und Wettbewerb befreunden. Die Freiburger Schule hatte einen großen Anteil daran. Dies könnte nun das Happy End sein. Soziale Marktwirtschaft hat sich durchgesetzt, und gut. Nun geht die Rede aber noch weiter. Und es ist ja auch so: Wir wollen nicht sagen, dass es gut sei. Deutsche Unternehmen verkaufen weltweit erfolgreich ihre Produkte. Wir genießen Dank dieses wirtschaftlichen Erfolges nicht nur einen materiellen Wohlstand, sondern auch einen sozialen Standard, den es so nur in wenigen Ländern der Welt gibt. Und doch halten viele Deutsche die marktwirtschaftliche Ordnung zwar für effizient, aber nicht für gerecht. Mit Marktwirtschaft assoziieren sie laut einer aktuellen Umfrage gute Güterversorgung und Wohlstand, aber auch Gier und Rücksichtslosigkeit. Das ist nun freilich nichts Neues, ähnliche Forschungen in der Seele der Deutschen fördern seit Jahrzehnten relativ konstante Sympathien für staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zutage. Schon Bundespräsident Heuss sprach vom gefühlsbetonten Antikapitalismus der Deutschen, den er zu Recht für einen unreflektierten Antiliberalismus hielt. Für mich folgt daraus: Es wird nicht alles schlimmer. Salopp gesagt: Man muss nicht verzweifeln, wenn man wie ich die soziale Marktwirtschaft für eine Errungenschaft hält. Aber natürlich gibt es auch Grund zu fragen, woran so viele konstant zweifeln, nicht um den Zweifelnden zu folgen, sondern um ihnen zu begegnen. Für manche ist schon die Notwendigkeit das eigene Leben frei zu gestalten mehr Zumutung als Glück. Freiheit hat nicht nur die schöne, die Chancen eröffnende Seite, sie löst ja auch aus Bindungen, sie weckt damit Unsicherheit und Ängste. Immer ist der Beginn von Freiheit von machtvollen Ängsten begleitet. So klingt das Wort Freiheit bedrohlich für jemanden, der sich nicht nach Offenheit, sondern nach Überschaubarkeit sehnt. Und dann noch dieser ständige Zwang, die erreichte Position gegenüber anderen zu behaupten. Viele zweifeln am Wettbewerb, der unser Dasein bestimmt. Er beginnt spätestens in der Schule und begleitet uns nicht nur im Berufsleben oder im Unternehmen, sondern auch im Sport, in der Kunst, in der Kultur. Die Demokratie selbst ist ohne Wettbewerb ja gar nicht denkbar. Als Land stehen wir wiederum nicht nur mit unserer Wirtschaft, sondern auch mit unserem Gesellschaftsmodell im Wettbewerb mit anderen Nationen. Im Grunde aber finden allzu viele den Wettbewerb eher unbequem. Es ist anstrengend, sich permanent mit anderen messen zu müssen. Und wenn wir uns immer wieder neu behaupten müssen, dann können wir ja auch immer wieder scheitern. Das ist das Paradoxe an der freiheitlichen Ordnung. Ich kenne so viele, die sich einst fürchteten, eingesperrt zu werden, die Freiheit suchten und ersehnten. Aber jetzt fürchten sie sich vor ihr, fürchten sich auch, abgehängt zu werden. Das ist menschlich verständlich. Aber es lohnt zu erklären, was Wettbewerb vor allem ist, jedenfalls dann, wenn er fair ist, dann ist er eine öffnende Kraft. Er bricht althergebrachte Privilegien und zementierte Machtstrukturen auf und bietet dadurch Raum für mehr Teilhabe, mehr Mitwirkung. Er bietet, auch im Falle des Scheiterns, idealerweise eine zweite und weitere Chance. Und wenn er richtig 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 131 Volkswirtschaftliche Zielsetzungen 4.1 Die Nachfragetheorie1.1 Soziale Marktwirtschaft im Spannungsfeld aktueller Entwicklungen Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C. C. B uc hn er V rla gs | |
 « | 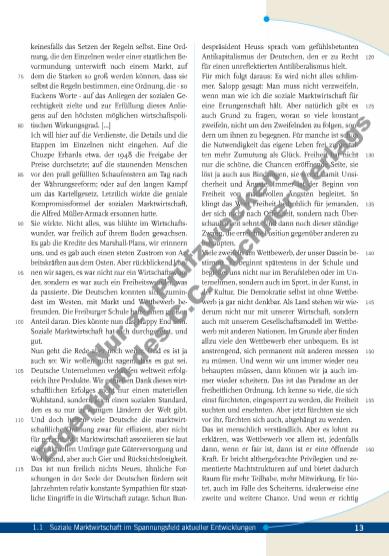 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |