| Volltext anzeigen | |
Freiheit des Individuums (Liberté), die Gleichheit der Bürger (Egalité) sowie, weniger deutlich und wirksam, die Brüderlichkeit (Fraternité) aller Menschen. Die „Charta der modernen Demokratie“ (François Furet) hatte jedoch noch Lücken. So löste sie die noch schwache Forderung nach der Gleichberechtigung der Geschlechter nicht ein. Von zentraler Bedeutung während der Verfassungsberatungen war die Frage, welche Kompetenzen dem Monarchen künftig zugestanden werden sollten. Seine Exekutivgewalt wurde nicht infrage gestellt, aber in der Gesetzgebung räumte die Mehrheit der Deputierten dem König nur noch ein aufschiebendes Einspruchsrecht (suspensives Veto) ein, mit dem er Gesetze zwar nicht generell verhindern, aber für vier Jahre blockieren konnte. Trotz dieser Zugeständnisse wollte der König die Verfassung zunächst nicht anerkennen. Während man in Versailles die Verfassung beriet, hungerten viele Einwohner von Paris. Mit der Bemerkung „Die Männer trödeln, die Männer sind feige, jetzt nehmen wir die Sache in die Hand“ zogen am 5. Oktober 1789 etwa 6 000 Frauen nach Versailles, um gegen die Not zu demonstrieren; ihnen folgten rund 20 000 Nationalgardisten. Im Verlauf des Protestes erkannte Ludwig XVI. die von der Verfassunggebenden Nationalversammlung erarbeiteten Verfassungsartikel an, auch die Menschenrechtserklärung. Um ihn besser kontrollieren zu können, wurde der König gezwungen, mit seiner Familie in die Hauptstadt zu ziehen; die Abgeordneten folgten ihm. Paris wurde Zentrum der Macht. Die Arbeit der Konstituante Die Revolution lähmte Handel und Gewerbe. Der Staat nahm kaum noch Steuern ein. Zur Sanierung des Staatshaushaltes beschlossen die Abgeordneten auf Vorschlag des Bischofs von Autun, Charles Maurice Talleyrand, die Verstaatlichung der Kirchengüter. Orden und Klöster wurden aufgelöst. Die Versteigerung der kirchlichen Güter begann. Die Nationalisierung der Kirchengüter hatte eine staatliche Kirchenverfassung zur Folge. Der Staat übernahm die sozialen Aufgaben des Klerus, wie den Unterhalt von Schulen, die Krankenund Armenpfl ege, und machte aus Bischöfen und Geistlichen Staatsdiener. Eine weitere spektakuläre Entscheidung der Abgeordneten war die Abschaffung des erblichen Adels am 19. Juni 1790. Bei den folgenden Bemühungen, Staat und Wirtschaft neu zu ordnen, konnten die Abgeordneten zum Teil auf die im Ancien Régime begonnenen Reformen zurückgreifen. Die nun durchgeführten Verwaltungs-, Justiz-, Finanz-, Steuerund Gemeindereformen griffen ineinander und wurden parallel zu einer Neueinteilung des Landes in 83 etwa gleich große Verwaltungsbezirke (Départements) vollzogen. Die Binnenzölle fi elen und die Berufsund Gewerbefreiheit wurde eingeführt. Ganz im Sinn der neuen Wirtschaftsordnung wurde auch den Handwerkern und Arbeitern das Recht auf Vereinigung und Streik im Juni 1791 genommen; die Regelung blieb bis 1864 bzw. 1884 bestehen. Frankreich wird konstitutionelle Monarchie Durch einen Fluchtversuch ins Ausland, der am 20. Juni 1791 scheiterte, verlor Ludwig XVI. seine Glaubwürdigkeit und sein Ansehen – bei den Deputierten und in der Bevölkerung. Die Mehrheit der Abgeordneten wollte dennoch die Revolution beenden, um endlich wieder zu stabilen Verhältnissen zurückzukehren. Am 14. September 1791 musste Ludwig XVI. einen Eid auf die von der Konstituante verabschiedete Verfassung ablegen. Aus Frankreich war eine konstitutionelle Monarchie geworden. Der König stand nicht mehr „über dem Gesetz“, sondern regierte „nur durch dieses“, wie es die Verfassung bestimmte. i Olympe de Gouges. Pastellminiatur von 1785. Die 1748 geborene Schriftstellerin verfasste 1791 die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“. Frauen übernahmen im revolutionären Alltag eine wichtige Rolle. Sie demonstrierten gegen Missstände, entsandten Deputationen und meldeten sich mit Petitionen und Streitschriften zu Wort. Einige organisierten sich auch in eigenen Klubs, die allerdings im Oktober 1793 verboten wurden. Später stellten Frauen auch eigene freiwillige Regimenter für den Kampf gegen die Feinde der Revolution auf. Trotzdem wurden ihre Forderungen, sie in Ausbildung, Beruf, Ehe und Familie besserzustellen, kaum berücksichtigt. Darüber hinaus blieben sie weiterhin ohne Wahlrecht und wurden von der Mitarbeit in Kommunen und im Parlament ausgeschlossen. Es kam auch zu verbalen Diskriminierungen in der Presse. Einige Frauen wurden ins Gefängnis geworfen, andere starben auf dem Schafott. Auch Olympe de Gouges ereilte dieses Schicksal, sie wurde am 3. November 1793 hingerichtet. Konstitutionelle Monarchie: Regierungsform, in der die absolute Macht des Monarchen durch eine Verfassung gesetzlich begrenzt wird. Ein König steht zwar weiterhin an der Spitze des Staates, an der Gesetzgebung aber wirkt ein Parlament mit. 165Die Französische Revolution Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn e V er la gs | |
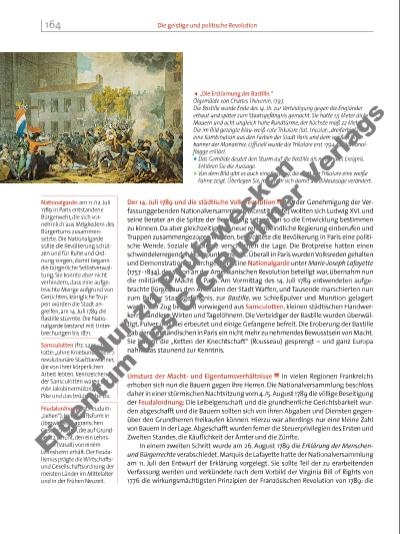 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |