| Volltext anzeigen | |
M2 Für und wider das Zensuswahlrecht Der Parlamentsadvokat Orry de Mauperthuy schreibt am 4. De zember 1789 in der „Chronique de Paris“: Trotzdem gibt es eine Klasse von Menschen und Mitbrüdern, die infolge der schlechten Gestaltung unserer Gesellschaften zur Vertretung der Nation nicht berufen werden können. Das sind die heutigen Proletarier. Nicht weil sie arm und bloß sind, sondern weil sie nicht einmal die Sprache unserer Gesetze verstehen. Überdies ist ihre Ausschließung nicht ewig, sondern nur ganz vorübergehend. Vielleicht wird sie ihren Wetteifer anstacheln, unseren Beistand herauszufordern. In wenigen Jahren werden sie an unserer Seite sitzen, und wie man es in einigen Schweizer Kantonen sieht, wird ein Hirt, ein Bauer von der Donau oder vom Rhein, der würdige Vertreter seines Volkes sein. Noch besser wäre es (wenn hieraus der sterbenden, aber noch nicht toten Aristokratie kein Beistand erwüchse), sich lediglich auf das Vertrauen der Wähler zu verlassen. Das ist der einzige unverletzliche Grundsatz [...]. Am 20. April 1791 hält der 31-jährige Abgeordnete Maximilien Robespierre1 aus dem nordfranzösischen Arras in dem im April 1790 gegründeten „Club des Cordeliers“2 eine Rede über das Zensuswahlrecht. Sie wird gedruckt und fi ndet so große Verbreitung: Alle Menschen, die in Frankreich „geboren und wohnhaft“ sind, sind Mitglieder jener politischen Gemeinschaft, die man die französische Nation nennt; das heißt, sie sind französische Bürger. Sie sind es von Natur aus und durch die allem voranstehenden Grundsätze der Menschenrechte. Die Rechte, die an diesen Titel geknüpft sind, hängen weder von dem Vermögen ab, das jeder von ihnen besitzt, noch von der Höhe der Steuer, die ihm auferlegt wird, denn es ist nicht die Steuer, die uns zu Bürgern macht. Die Eigenschaft, Bürger zu sein, verpfl ichtet nur, zu den gemeinsamen Ausgaben des Staates beizutragen, und zwar je nach den Möglichkeiten des Einzelnen. Gewiss, Sie können den Bürgern Gesetze geben, aber sie als Bürger ignorieren, das können Sie nicht. Die Anhänger des Systems, das ich hier angreife, haben diese Wahrheit selbst gespürt, denn sie haben es nicht gewagt, denjenigen, die sie zur politischen Enterbung verurteilten, die Eigenschaft des Bürgers einfach zu bestreiten, sondern sie haben sich darauf beschränkt, den Grundsatz der Gleichheit, den sie notwendigerweise voraussetzen, durch die Unterscheidung von aktiven und passiven Bürgern zu umgehen. Sie haben sich darauf verlassen, dass die Menschen mit Worten leicht zu regieren sind, und so haben sie uns hinters Licht zu führen versucht, indem sie die offensichtlichste Vergewaltigung der Menschenrechte in diesen neuartigen Begriff gekleidet haben. [...] Das Volk verlangt nur das Notwendige, es will nur Gerechtigkeit und Ruhe; die Reichen dagegen erheben auf alles ihren Anspruch, sie wollen überall an Einfl uss gewinnen und alles beherrschen. Der Missbrauch ist das Werk und Wirkungsfeld der Reichen; sie sind die Geißel des Volkes: Das Interesse des Volkes ist das Allgemeininteresse, das Interesse der Reichen ist das Einzelinteresse; und Sie wollen das Volk machtlos und die Reichen allmächtig machen! [...] Ach! Wer könnte also den Gedanken ertragen, das Volk seiner Rechte beraubt zu sehen durch eben die Revolution, die nur durch den Mut des Volkes und die liebevolle und großmütige Anhänglichkeit, mit der es seine Repräsentanten verteidigt hat, möglich gewesen ist! Verdanken Sie denn den reichen und den großen Leuten diesen ruhmreichen Aufstand, der Frankreich und auch Sie gerettet hat? Erster Text: François-Alphonse Aulard, Politische Geschichte der französischen Revolution: Entstehung und Entwicklung der Demokratie und der Republik 1789 1804, Bd. 1, Verdeutschg. von Friedrich von Oppeln-Bronikowski, München 1924, S. 56 f. Zweiter Text: Maximilien Robespierre, Ausgewählte Texte, Hamburg 21989, S. 40 f. und 48 ff. (übersetzt von Manfred Unruh, stark gekürzt) 1. Arbeiten Sie die unterschiedlichen Positionen zum Zensuswahlrecht heraus und nehmen Sie Stellung. 2. Erläutern Sie, worauf sich Robespierre in seiner Argumentation stützt. 1 Siehe Seite 167. 2 Club des Cordeliers: Klubs wie der Jakobinerklub und der Club des Cordeliers wurden während der Französischen Revolution zum Sammelpunkt politisch interessierter Bürger und Mandatsträger. Mitglieder waren zumeist Akademiker und Angehörige des Besitzbürgertums. Im Club des Cordeliers sammelte sich die kleinbürgerliche städtische Volksbewegung (Sansculotten). In den Klubs wurde einerseits die Arbeit von Deputierten und Stadtverordneten diskutiert und vorbereitet, andererseits wurden von hier aus Petitionen und Demonstrationen in Gang gebracht. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 u Maximilien Robespierre. Anonymes französisches Gemälde (60 x 49 cm), um 1790. 169Die Französische Revolution Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
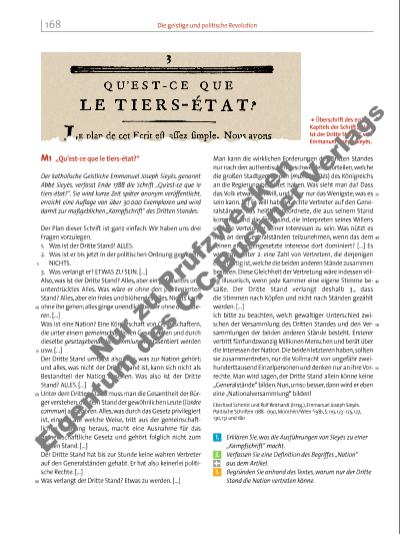 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |