| Volltext anzeigen | |
Anfänge der liberalen und nationalen Bewegung in den deutschen Staaten Die Bestimmung des Menschen als eines freien, vernunftgeleiteten, selbstverantwortlich handeln den Individuums geht auf die europäische Aufklärung zurück. Sie bildet die geistesge schicht liche Grundlage für die im 18. Jahrhundert ent wickelte liberale* und nationale Bewegung. Die Amerikanische und die Französische Revolution sowie die aus der napoleonischen Fremdherrschaft entstandenen Krisen stärkten sie. Insge samt bestimmten drei parallel verlaufende und sich zum Teil überschneidende Prozesse die Be we gung: • Der Kampf gegen die Fremdherrschaft sowie die inneren Reformen stärkten die Bewegung. Da bei mobilisierten die Befreiungskriege nicht die Mas sen, wie es später dargestellt wurde. Die meis ten Soldaten mussten zum Kriegsdienst ge gen die französischen Truppen gezwungen wer den. • Auch der Aufstieg des Bürgertums verlieh der Bewegung wichtige Impulse. Es gab sich nicht mehr mit der stän dischen Ordnung und der politischen Un mün digkeit zufrieden. Die von den Fürsten eingeleiteten Modernisierungen hatten seine Macht gestärkt. • Schließlich gab es im frühen 19. Jahrhundert ein wachsendes Bewusstsein, einer deutschen Kulturnation anzugehören. Den Gedanken, dass ein Volk durch Sprache, Religion und Tradition ein bestimmtes Nationalbewusstsein besitzt, hatte Johann Gottfried Herder (1744 1803) in seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ von 1772 entwickelt. Theologen, Schriftsteller, Historiker, Philosophen und andere Intellektuelle trugen dazu bei, dass diese Gedanken diskutiert, erweitert und publiziert wurden. Für die Schaffung eines deutschen Nationalstaates stand allerdings – anders als in Frankreich, wo sich die Nation innerhalb einer bestehenden Staatsgrenze gegründet hatte – nicht das Modell der Staatsnation Pate. Daher griff man im Gebiet der deutschen Staaten auf die Idee der Kulturnation zurück und knüpfte damit an Überzeugungen aus dem 18. Jahrhundert an. Damals hatte sich unter bürgerlichen Beamten, Kaufl euten und Literaten das Bewusstsein herausgebildet, über alle Grenzen der Reichsterritorien hinweg als Nation zusammenzugehören. Nach 1806 wurde die deutsche Vergangenheit in Literatur, Kunst und Musik romantisch verklärt und die gemeinsame Sprache und Kultur zur Grundlage der Nation und eines erhofften Nationalstaates erhoben. Wenige Jahre vor der Revolution von 1848 entstand „Das Lied der Deutschen“, ein Werk aus drei Strophen, das von den Noten der „KaiserHymne“ von Joseph Haydn begleitet wurde. August Heinrich Hoffmann hatte den Text Ende August 1841 während des Besuches der Nordseeinsel Helgoland verfasst. Ein Jahr zuvor hatte Hoffmann mit seinen „Unpolitischen Liedern“ die Zustände im Deutschen Bund spöttisch kritisiert. Dafür verlor er 1842 seine Professur an der Universität Breslau und wurde aus mehreren deutschen Staaten und Städten ausgewiesen – allein dreimal aus seinem Heimatort, nach dem der Dichter sich „von Fallersleben“ (heute ein Stadtteil von Wolfsburg) nannte. Auch wenn es noch über 70 Jahre dauern sollte, bis „Das Lied der Deutschen“ 1922 schließlich zur deutschen Nationalhymne erklärt wurde, so verweist der Entstehungshintergrund des Textes noch heute auf die nationalen Bestrebungen des 19. Jahrhundertes, steht die wechselhafte Geschichte der Verwendung der Hymne gleichsam für das Auf und Ab der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. * liberalis (lat.): „freiheitlich“, „eines freien Mannes würdig“ i „Reden an die deutsche Nation“ von Johann Gottlieb Fichte und „Des Knaben Wunderhorn“ von Clemens Brentano und Achim von Arnim. Fichte war einer der bedeutendsten Propagandisten des deutschen Natio nalbewusstseins. Mit seinen „Reden an die deutsche Nation“ von 1808 forderte er die demokratische Nationalerziehung als Grundlage eines aus gleichberechtigten Bürgern bestehenden deutschen Nationalstaates. Die von den bedeutendsten Dichtern der Romantik, Brentano und Arnim, zwischen 1806 und 1808 veröffentlichte dreibändige Volksliedsammlung „Des Knaben Wunderhorn“ gehört zu einer großen Reihe von in dieser Zeit verbreiteten Volksliedern, Märchen, Legenden und Sagen, die über die kulturelle Tradition eine politische und geistige Einheit der Deutschen stiften sollten. 229Deutschland im Schatten Napoleons N zu P rü fz ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
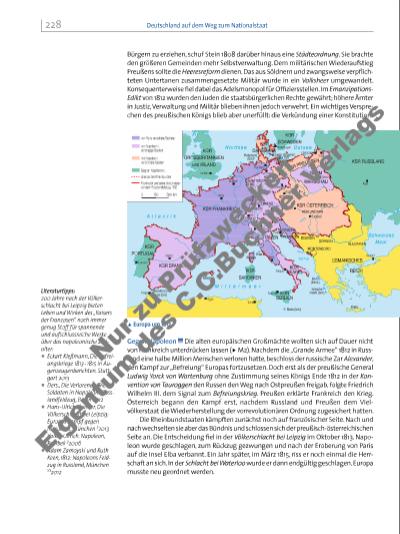 « | 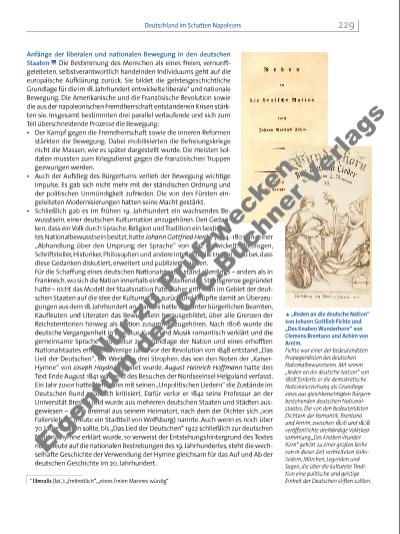 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |