| Volltext anzeigen | |
Unvereinbarkeit der Standpunkte sah die Verfassung keine ausdrückliche Regelung vor. Bismarck entwickelte für diesen Fall die sogenannte Lückentheorie, nach der in dieser Situation dem König als Souverän die letzte Entscheidung zufalle. Nach dem Sieg Preußens über Österreich 1866 suchte Bismarck im Verfassungskonfl ikt eine Verständigung mit den Liberalen. Diese spalteten sich an der von Bismarck vorgelegten Indemnitätsfrage, die den Verfassungskonfl ikt beenden sollte. Ergebnis des Streits der Liberalen war die Gründung der Nationalliberalen Partei im Jahr 1867. Diese setzte darauf, dass die baldige Schaffung eines Nationalstaates eine libe ralere Gesellschaftsordnung und eine Stärkung des Parlaments nach sich ziehen würde. Nationalbewegungen Auch nach der gescheiterten Reichseinigung 1849 lebte die Nationalbewegung fort. König Wilhelm I. tolerierte das Wirken des neu gegründeten, „kleindeutsch“ gesinnten Nationalvereins und weigerte sich, auf ihn die beschränkende Bundesvereinsgesetzgebung anzuwenden. Auch das konservative Lager nahm immer stärker eine positive Haltung gegenüber der kleindeutschen Einigung ein. Österreich behielt gegenüber der Nationalbewegung einen ablehnenden Kurs. Dennoch nahmen an den zahlreichen Nationalfesten, die vor allem Sänger-, Turnerund Schützenvereine ausrichteten, immer mehr Deutschösterreicher teil. Anlässe boten Friedrich Schillers hundertster Geburtstag am 10. November 1859 oder das Gedenken an die erfolgreichen Befreiungskriege gegen Napoleon. Preußisch-österreichischer Dualismus Die Gegensätzlichkeit der beiden führenden deutschen Mächte zeigte sich insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Im Zollverein* fürchtete Preußen um seine Vormachtstellung und verweigerte sich einer Aufnahme Österreichs. Die Rückständigkeit seiner Industrie zwang Österreich zu einer Schutzzollpolitik – im Gegensatz zur Freihandelspolitik Preußens. Dessen fortschrittliche Handelsund Wirtschaftspolitik nahmen sich andere deutsche Staaten für eigene Reformen zum Vorbild, um die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu steigern. Auch in Fragen einer Reform des Deutschen Bundes bezog Preußen eigene Positionen. So lehnte es eine von Österreich betriebene Reformakte von 1863 ab, um einer Stärkung des Bundes unter österreichischer Führung entgegenzuwirken. Mit der Befürwortung einer direkt gewählten Volksvertretung für den Deutschen Bund machte es sich eine liberale Forderung zu eigen. Im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 waren die beiden deutschen Großmächte noch Verbündete. Sie besiegten Dänemark, das versucht hatte, Schleswig zu annektieren, und setzten sich gemeinsam über den Wunsch der Nationalbewegung hinweg, die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein von einem deutschen Fürsten regieren zu lassen. Sie teilten sich die Verwaltung der beiden Herzogtümer. Doch schon bald wurde deutlich, dass Bismarck Schleswig-Holstein preußischem Einfl uss unterwerfen wollte. Das österreichische Vorgehen, nun den Bundestag einzuschalten, erklärte Preußen als Bruch der bestehenden zweiseitigen Vereinbarungen und marschierte in Holstein ein. * Siehe Seite 190. i „Das Einzige und der Einzige.“ Holzschnitt von Wilhelm Scholz aus dem „Kladderadatsch“ vom 13. November 1859. Zum 100. Geburtstag Friedrich Schillers am 10. November 1859 fanden in 440 deutschen Orten Festakte statt. Das Bild spielt auf die Grundsteinlegung eines Schiller-Denkmals in Berlin an. p Charakterisieren Sie die dargestellten Personen und erklären Sie den Titel. Indemnität: nachträgliche Billigung einer Regierungsmaßnahme 249Auf dem Weg zur Reichsgründung Nu r z u Pr üf zw ec ke n E g nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 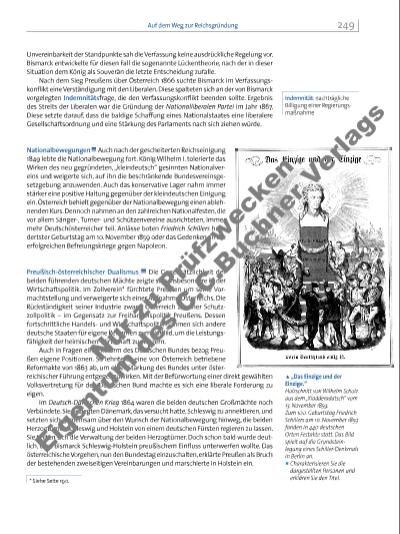 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |