| Volltext anzeigen | |
257Politische Kultur im Kaiserreich Bismarck betrachtete das Zentrum als verlängerten Arm der römischen Kurie und als wichtigstes Sprachrohr der oppositionellen Kräfte des Reiches. Eine ähnliche Auffassung vertraten die Liberalen. Sie forderten einen konfessionell neutralen Staat und kämpften gegen ein in ihren Augen überholtes Weltund Menschenbild sowie ein Bildungsund Schulsystem unter kirchlicher Aufsicht. Besondere Herausforderungen waren für sie der Syllabus errorum (1864) und das sogenannte Unfehlbarkeitsdogma (1870). In einer Reihe von Maßnahmen versuchte Bismarck, die katholische Kirche und deren Amtsträger im Deutschen Reich der staatlichen Kontrolle zu unterwerfen und ihren Einfl uss zurückzudrängen. Der „Kanzelparagraf“ unterband als erstes 1871 die politische Öffentlichkeitsarbeit der katholischen Kirche. 1872 wurde ein neues Schulaufsichtsgesetz beschlossen, das Geistliche der staatlichen Kontrolle unterwarf. Das Verbot des Jesuitenordens (1872), das Expatriierungsgesetz (1874), welches politisch unzuverlässige Geistliche mit Ausweisung bedrohte, und das „Brotkorbgesetz“, welches die Einstellung staatlicher Zahlungen an die Kirche für den gleichen Fall vorsah, ergänzten die staatlichen Disziplinierungsmaßnahmen. Bismarcks Unterdrückungspolitik blieb erfolglos. Die Gläubigen stellten sich nicht nur auf die Seite ihrer Kirche, sondern festigten ihren Zusammenhalt. Das Zentrum konnte deshalb seine Wählerzahlen deutlich steigern. Da Bismarck zur Unterstützung seiner geänderten Wirtschaftsund Finanzpolitik das Zentrum benötigte, nahm er die meisten Kampfgesetze wieder zurück. Vor allem die staatliche Schulaufsicht und die Einrichtung der Zivilehe (seit 1874/75) blieben aber weiterhin bestehen. Die Aussöhnung Bismarcks mit dem Zentrum ist ein prägnantes Beispiel für seine „Schaukelstuhlpolitik“. Angst vor der „roten Gefahr“ Zur Gruppe der „Reichsfeinde“, die eine Änderung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse anstrebten, zählte der konservative Bismarck auch die Parteien der Arbeiterbewegung. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1871 hatte die Pariser Kommune gegen den Willen der französischen Zentralregierung die Hauptstadt für einige Monate nach sozialistischen Vorstellungen verwaltet und gegen Regierungstruppen unnachgiebig verteidigt. Seitdem war die Angst vor der „roten Gefahr“ auch in Deutschland in weiten Kreisen lebendig. Den sozialis tischen Kräften wurde dann auch die Schuld an der verschlechterten wirtschaftlichen Lage nach dem Börsenkrach 1873 zugeschoben. Mithilfe einer Doppelstrategie hoffte Bismarck, die Arbeiterschaft von der Sozialdemokratie zu lösen. Zum einen sollte die Sozialgesetzgebung die Situation der Arbeiter verbessern.* Zum anderen benutzte er auch hier das Strafrecht. Zwei Attentate, nach denen der Widerstand der liberalen Reichstags abgeordneten bröckelte, dienten ihm dafür als Anlass. Das umstrittene „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ (Sozialistengesetz) von 1878, das bis 1890 mehrfach verlängert wurde, richtete sich gegen Vereine, Versammlungen, Druckschriften und Beitragssammlungen, „welche durch sozialdemokratische, sozialistische und kommunistische Bestre bungen den Umsturz der bestehenden Staatsund Gesellschaftsordnung bezwecken“. Betroffen waren auch die der Partei nahe stehenden Gewerkschaften. Führende „Agitatoren“ konnten aus ihren Wohnorten ausgewiesen werden. Viele in die Illegalität gedrängte Sozialdemokraten wurden verhaftet und verurteilt. Allerdings behielt die Reichstagsfraktion ihre parlamentarischen Rechte; sozialdemokratisch gesinnte Kandidaten konnten weiterhin gewählt werden. * Siehe Seite 212 f. t „Der Kampf des Riesen gegen den Zwerg.“ Karikatur auf das Sozialistengesetz aus dem „Wahren Jacob“ von 1890. Syllabus errorum: 1864 listete Papst Pius IX. 80 „Irrtümer“ auf. Sie betrafen vor allem die anderen christlichen Konfessionen sowie liberale Grundsätze wie die Trennung von Kirche und Staat. Unfehlbarkeitsdogma: Das erste Vatikanische Konzil legte 1870 fest, dass der Papst in Fragen der Glaubensund Sittenlehre unfehlbar sei. Nu r z u P üf zw ec ke Ei g nt um d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 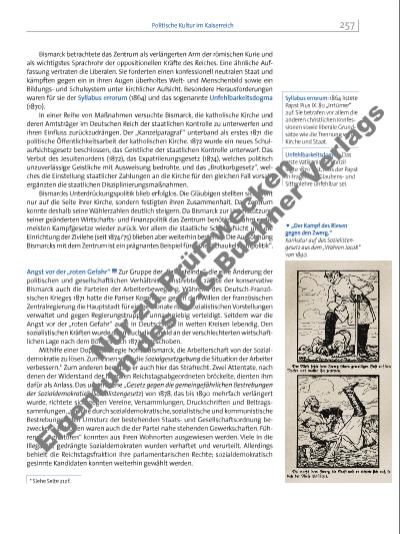 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |