| Volltext anzeigen | |
259Politische Kultur im Kaiserreich Parteien und Verbände gegründet. 1893 zogen bereits 16 antisemitische Abgeordnete in den Reichstag ein. Auch in die Parteiprogramme der Konservativen gelangten antijüdische Ressentiments. Der parteipolitisch organisierte Antisemitismus fand bevorzugt in Phasen wirtschaftlicher Krisen Zulauf, vor allem bei städtischen Mittelschichten und der Landbevölkerung. Aber auch im Offi zierskorps und unter der akademischen Jugend wurde die Ablehnung der Juden salonfähig. Der preußisch-deutsche Militarismus Als ein wichtiger gesellschaftlicher Integrationsfaktor kristallisierte sich das Militär heraus. Seine Hochschätzung offenbarte die militante Seite des zeitgenössischen Nationalismus. Publikumswirksam stellten die Streitkräfte in Manövern, bei Paraden, Wachwechseln, Fahnenweihen und Darbietungen von Militärmusik ihre Stärke und ihr Können öffentlich vor. „Das deutsche Heer ist unzweifelhaft das allerrealste und wirksamste Band der nationalen Einheit geworden und gewiss nicht, wie man früher hoffte, der Deutsche Reichstag.“ So urteilte 1897 Heinrich von Treitschke. Das hohe Ansehen des Militärs war seit den Freiheitskriegen gegen Napoleon bis zum Sieg 1870/71 ständig gewachsen. Seine Anerkennung als vorbildhafter „Erster Stand“ über den gesellschaftlichen Gruppen war ein prägendes Charakteristikum des Kaiserreiches. Der alleinigen Befehlsgewalt des Kaisers unterstellt, fühlte sich das Militär als „Staat im Staate“. Vor allem die Offi ziere pfl egten einen aristokratischen, demokratiefeindlichen, mitunter antisemitischen Kastengeist. Selbst für bürgerliche Reserveoffi ziere konnte sich der Dienst im Militär förderlich auf die Karriere auswirken. Die Uniform verlieh im Kaiserreich Autorität und verschaffte Privilegien wie z. B. ermäßigte Eintrittsgelder oder die Zuweisung der besten Plätze im Restaurant. Bismarck und andere Politiker traten mit Vorliebe in Uniform auf die Rednerbühne. Schon Kinder wurden in Matrosenanzüge gekleidet. An patriotischen Festtagen erschien sogar der Gymnasiallehrer in der Öffentlichkeit in „Kaisers Rock“. Militärische Werte und Verhaltensweisen spiegelten sich ebenso in den Erziehungsidealen und Riten studentischer Verbindungen. Und in so manche Amtsstuben führten die nach zwölf Dienstjahren entlassenen ehemaligen Unteroffi ziere den barschen Ton auch als zivile Beamte ein. Respekt vor Autoritäten und Unterordnung wurden den Kindern bereits im Elternhaus und in der Schule beigebracht. Der militaristische Geist, der die Gesellschaft erfasst hatte, wurde besonders durch mitgliederstarke Organisationen ehemaliger Kriegsteilnehmer, „vaterländische“ Agitationsvereine (Deutsche Kolonialgesellschaft, Deutscher Flottenverein) oder den 1912 gegründeten „Wehrverein“ gefördert. Vor allem der radikalnationalistische Alldeutsche Verband pfl egte seit den 1890er-Jahren eine aggressive Agitation gegen das „revanchelüsterne“ Frankreich, gegen die slawischen Völker, gegen das „perfi de Albion“ (England) und nicht zuletzt auch gegen die Juden. Ob die Wilhelminische Gesellschaft allerdings nur als „Untertanengesellschaft“ charakterisiert werden kann, bleibt mit guten Gründen zu bezweifeln (u M3). In starker Konkurrenz zu einer national-konservativen Ausrichtung waren die Anliegen des Liberalismus in der Öffentlichkeit weithin präsent (u M4). i Kinder exerzieren am Strand von Swinemünde. Foto von 1913. Aus erzieherischen Gründen stiftete Kunstmaler Georg Schmitt ein Schiffsmodell, an dem Kinder und Jugendliche in Marineuniformen Soldat spielen konnten. Alldeutscher Verband: 1891 gegründet, setzte sich die nationalistische Organisation für eine Stärkung und Verbreitung des Deutschtums ein und befürwortete eine imperalistische Politik. Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge tu m d s C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 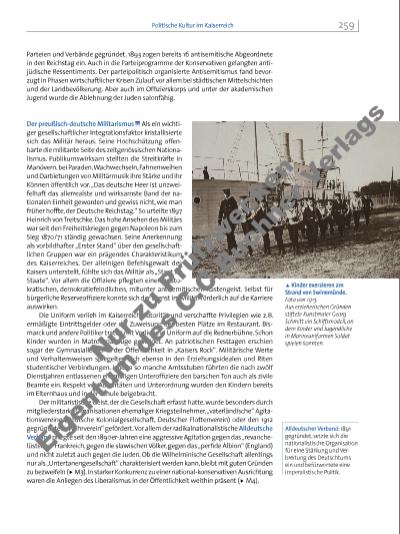 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |