| Volltext anzeigen | |
103Expansion im Industriezeitalter: Motive und Grundzüge des europäischen Imperialismus Formen imperialer Herrschaft Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts überwogen in den europäischen Kolonialreichen indirekte Herrschaftsmethoden (informeller Imperialismus oder indirect rule). Es wurden bei spielsweise Verträge mit lokalen Machthabern abgeschlossen, die auf die Öffnung der Märkte und die Sicherung des wirtschaftlichen und politischen Einfl usses der Europäer abzielten. Sie wurden notfalls mit diplomatischem oder militärischem Druck durchgesetzt. Alles Weitere überließ man den Kaufl euten, Siedlern, Offi zieren und Missionaren vor Ort, den „men on the spot“. Oftmals bezog sich die Kontrolle nur auf die Küstenregionen eines Landes oder einzelne Stützpunkte. Die bestehenden staatlichen und wirtschaftlichen Ordnungen, Lebensgewohnheiten und Ge bräuche der einheimischen Gesellschaften blieben weitgehend unangetastet. Die europäischen Rivalitäten um Kolonialbesitz seit den 1880er-Jahren führten zu einer Verbreitung direkter, auf politisch-militärischer und wirtschaftlicher Kontrolle basierender Herrschaftsmethoden (formeller Imperialismus oder direct rule). Indirekte Herrschaftsmethoden verschwanden jedoch nicht. Vor allem in China* und im Osmanischen Reich basierte der Einfl uss der imperialistischen Mächte weitgehend auf wirtschaftlicher Durchdringung und Kontrolle. Überhaupt konnte die reale Durchsetzung von Herrschaft in der Praxis sehr unterschiedlich aussehen. Während in manchen Gebieten kaum von effektiver Herrschaft gesprochen werden kann, etablierten sich im belgischen Kongo-Freistaat, im britischen Südafrika oder in Deutsch-Südwestafrika gewaltsame Unterdrückungsregime. Die Herrschaftsform war jeweils von den verwaltungsmäßigen Zugriffsmöglichkeiten vor Ort, dem militärischen Potenzial und den unterschiedlichen herrschaftsideologischen Grundsätzen der Kolonialmächte abhängig. Sogar innerhalb des britischen Empire existierten ganz unterschiedliche Verwaltungsund Herrschaftsformen nebeneinander. Generell bevorzugten die Briten jedoch wo immer möglich das Konzept der indirekt-informellen Herrschaft, das unter möglichst geringem personellen und fi nanziellen Aufwand die britischen Wirtschaftsund Kapitalinteressen sicherstellte. Die Briten beließen den regionalen Herrschern nach außen ihre Autorität, während diese zugleich – gelenkt durch britische Residenten – zur Errichtung der Fremdherrschaft beitrugen. Anders gingen die Franzosen vor (u M6). Da Selbstregierung dem republikanischen Einheitsgedanken widersprach, wurden die Kolonien direkt von Paris aus gelenkt und von französischen Gouverneuren vor Ort verwaltet. Frankreich verfolgte das Herrschaftsprinzip der Assimilation: Die Kolonien sollten dem Mutterland in jeder Hinsicht angeglichen und die Bevölkerung zu Franzosen „umerzogen“ werden. Um die Jahrhundertwende beschränkte man sich schließlich weitgehend auf eine organisatorische Anbindung an das Mutterland und gestand den Kolonien mehr Autonomie zu. * Dazu mehr auf S. 114 ff. i Zeitgenössische Karikatur auf die französische „Assimiliationspolitik“. Hier ist der Gouverneur von Madagaskar in der Tracht der Eingeborenen, die letzte Königin von Madagaskar, Ranavalona III. (1883 1897), hingegen in europäischer Kleidung dargestellt. Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei g nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 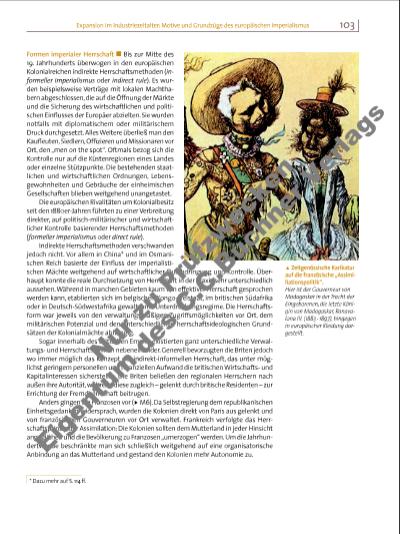 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |