| Volltext anzeigen | |
207Lebensund Arbeitsbedingungen im Wandel Umweltverschmutzung Das Bevölkerungswachstum und die Konzen tration der Menschen in den Städten brachten Probleme für die Wasserversorgung mit sich. Fäkalien, Schmutz und Unrat aus privaten Haushalten wurden in der Regel entweder durch Gräben entfernt oder mit Fässern abtransportiert. Wassertoiletten und Schwemmkanalisationen waren so gut wie unbekannt. Erst um die Mitte des 19. Jahr hunderts begann man mit dem systematischen Bau von Kanalisationssystemen in den großen Städten. Kanalisation und sauberes Trinkwasser sorgten für eine enorme Verbesserung der sanitären und hygienischen Verhältnisse in den Städten (u M3). Diese Art der Abwasserentsorgung brachte jedoch bald ein neues Problem mit sich. Durch das Einleiten von Abwässern aus Haushalten und Fabriken in die Flüsse wurden diese so stark verschmutzt, dass sie kaum noch als Trinkwasserreservoirs infrage kamen. Gerade viele kleinere Flüsse verkamen zu Kloaken. Gleichzeitig wurde das öffentliche Gesundheitswesen ausgebaut. Ein Großteil der medizinischen Versorgung der Bevölkerung wurde nun von staatlichen und kommunalen Einrichtungen übernommen. In den Jahren zwischen 1877 und 1913 verdoppelte sich die Zahl der Krankenhäuser, auch die Zahl der niedergelassenen Ärzte stieg. Für die Kosten kam zum größten Teil die im Rahmen der Sozialgesetzgebung eingeführte Krankenversicherung auf.* Gegen die negativen Folgen der Industrialisierung für Mensch und Natur regte sich bereits früh Protest. Die Anwohner der Fabriken klagten häufi g gegen die Belästigungen und Gefährdungen, die von den gewerblichen Anlagen ausgingen. Allerdings blieben ihre Beschwerden in der Regel erfolglos. Das Wissen um die Auswirkungen der Umweltverschmutzung war noch gering, man betrachtete den Rauch und Gestank als notwendiges „Culturübel“, das man hinnehmen musste. Da es keine geeigneten Messmethoden und wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über die Folgen der Umweltbelastung gab, war es im Einzelfall schwierig nachzuweisen, ob bestimmte Fabriken die Gesundheit der Anwohner gefährdeten. Für die Unternehmer war der Umweltschutz in erster Linie eine Kostenfrage. Solange es keine gesetzlichen Regelungen gab, wollte niemand die eigene Produktion durch einen höheren Aufwand bei der Entsorgung von Schadstoffen verteuern. Der Versuch der Behörden, mit Gewerbeordnungen die Beeinträchtigungen durch die Fabriken zu vermindern, erwies sich als ungeeignet. Auch der Bau höherer Schornsteine führte lediglich dazu, dass sich über den Städten bei ungünstiger Wetterlage Dunstglocken bildeten, die heute unter der englischen Bezeichnung „Smog“ bekannt sind. Erst durch die aufkommende Elektrifi zierung am Ende des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Qualität der Luft in den großen Städten wieder. Viele Fabriken stellten den Antrieb ihrer Maschinen von Dampfmaschinen und Transmissionssystemen auf Elektromotoren um. Trotzdem blieb durch die Verbrennung von Kohle und durch die Schadstoffe der Fabriken die hohe Belastung der Luft bestehen. i „Die Henrichshütte bei Hattingen am Abend.“ Ölgemälde (69 x 87 cm) von Eugen Bracht, 1912. * Siehe dazu S. 220 f. Nu r z u Pr üf zw ec ke n E ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
 « | 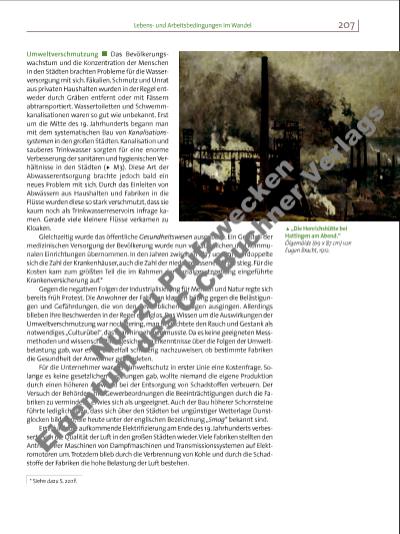 » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |