| Volltext anzeigen | |
215Ansätze zur Lösung der Sozialen Frage o „Der verhängnisvolle Weg der Arbeiter.“ Karikatur von 1891. Ansätze zur Lösung der Sozialen Frage Die Entstehung der „Sozialen Frage“ Das hohe Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert führte trotz wachsender Wirtschaft und damit der Zunahme an Beschäftigung zu einem Überangebot an Arbeitskräften. Die Löhne reichten häufi g nicht aus, um das Überleben der Familien zu sichern. Für die Industriearbeiter und die Lohnarbeiter in der Landwirtschaft, die nichts als ihre Arbeitskraft hatten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, wurde zeitgenössisch der Begriff Proletarier üblich. Frauen und Kinder waren gezwungen, zum Familieneinkommen beizutragen. Dadurch wuchs das Angebot an Arbeitskräften weiter, die Löhne blieben niedrig und die Arbeitsbedingungen schlecht. Die Beschäftigten litten unter den übermäßigen Belastungen. Tägliche Arbeitszeiten von 16 bis 18 Stunden waren keine Seltenheit. Gearbeitet wurde an sechs Tagen in der Woche, Urlaub gab es nicht. Lediglich die Sonnund Feiertage waren meist frei. Durch unzureichend gesicherte Maschinen und nicht ausreichend abgestützte Stollen in Kohlebergwerken kamen viele Bergleute zu Tode. Die Lebenserwartung war gering. Die Sterblichkeit der Arbeiterkinder lag wesentlich höher als in anderen Bevölkerungsschichten. Dazu trugen vor allem auch die schlechten Wohnverhältnisse bei, die häufi g Krankheiten hervorriefen. Immer mehr Menschen zogen in die Industriegebiete und waren in Großunternehmen tätig. Zwischen 1882 und 1907 verdoppelte sich die Arbeiterschaft in Deutschland, bis zum Ersten Weltkrieg wurde sie zur größten sozialen Gruppe. Trotz ihres wachsenden Anteils an der Bevölkerung blieben die Arbeiter lange ohne politische Mitbestimmung. Die Wahlsysteme bevorzugten häufi g Bürger mit großem Vermögen, so etwa das Dreiklassenwahlrecht in Preußen, das die unteren Schichten nahezu zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilte. Bereits die Zeitgenossen sahen die Not und die daraus erwachsenden sozialen Probleme. Sie dachten über Möglichkeiten nach, wie die Lebensumstände der Arbeiter verbessert werden konnten (u M1). So gründeten Mitte des 19. Jahrhunderts Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen unabhängig voneinander die ersten Genossenschaften, die Hilfe zur Selbsthilfe boten. Vorschussund Kreditvereine – die Vorläufer der heutigen Volksbanken – sollten den Mitgliedern Kredite für nötige Investitionen gewähren. Nur wenige Politiker bemühten sich noch um Maßnahmen, um die Lage von Handwerkern, Bauern und Arbeitern zu verbessern. Proletarier: Der Begriff leitet sich ab von der Bezeichnung für diejenigen Bürger im Alten Rom, die nichts anderes besaßen als ihre eigenen Nachkommen (lat. proles). Dreiklassenwahlrecht: Wahlsystem, bei dem die wenigen Großsteuerzahler der ersten Klasse (etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten) ebenso viele Abgeordnete wählen konnten wie die Masse der Bevölkerung (rund 80 Prozent). Ein großer Teil der Unterschichten blieb von den Wahlen ausgeschlossen. Genossenschaft: Zusammenschluss von selbstständigen Personen zu einem Geschäftsbetrieb. Damit können verschiedene Bereiche wie Einkauf, Lagerung oder Maschinenhaltung gemeinsam („genossenschaftlich“) betrieben und die Kosten verteilt werden. Nu zu P rü fzw ck en Ei ge tu m d e C .C .B uc hn e V er la gs | |
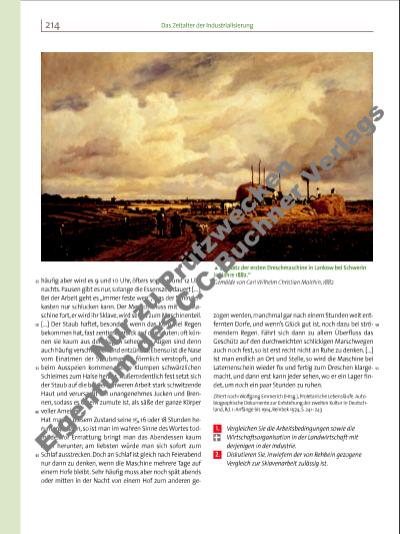 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |