| Volltext anzeigen | |
Christliche und islamische Welt Politische, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte Das Abendland hatte über Kaufleute, Pilger und Krieger, aber auch über Gelehrte, die das Wissen anderer Kulturen übersetzten und bekannt machten, vielfache Berührung mit fremden Vorstellungen. Im eigenen Land begegnete man mit den Juden einer Minderheit anderen Glaubens. Die orthodoxen Christen des Byzantinischen bzw. Oströmischen Kaiserreiches waren seit der Kirchenspaltung von 1054 von der lateinischen Christenheit des Westens durch gegenseitige Bannungen demonstrativ getrennt. Wiederholte Unionsverhandlungen zwischen der abendund der morgenländischen Kirche blieben erfolglos. Aber politische, wirtschaftliche und kulturelle Kontakte brachen nicht ab, sondern steigerten sich im Zeitalter der Kreuzzüge.* Zudem unterhielten die italienischen Stadtstaaten – allen voran Venedig – ein weitreichendes Handelsnetz bis ins Oströmische Reich und in die Levante (heute Libanon, Syrien, Israel). Zu Begegnungen katholischer Christen mit der islamischen Welt und ihrer Kultur kam es nicht nur infolge der Jerusalem-Wallfahrten und der Kreuzzüge. Wichtiger war die lange Nachbarschaft von Muslimen, Christen und Juden auf der Iberischen Halbinsel, in Sizilien und in Süditalien. Zusammenleben von Christen und Juden Die Zerstörung des Tempels und weiter Teile Jerusalems durch die römischen Eroberer im Jahr 70 n. Chr. bedeutete nicht nur das Ende des jüdischen Tempelkultes, sondern auch den Verlust staatlicher Unabhängigkeit in Palästina. Jüdische Gemeinden breiteten sich daraufhin über Kleinasien und Europa aus und lebten in christlicher oder islamischer Umwelt. Ein innerjüdisches Zusammengehörigkeitsgefühl blieb dank der religiösen Überzeugung von der Auserwähltheit des Volkes Israel über die Jahrhunderte auch in der Diaspora erhalten. Daher bildeten die Juden in ihrer jeweiligen Umgebung einen eigenen Lebenskreis, in dem o Jüdische Gemeinden und Siedlungsgebiete vom 1. bis zum 11. Jh. Diaspora (griech.: Zerstreuung): Gebiet, in dem die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft zerstreut unter einer Mehrheit Andersgläubiger leben. Der Begriff „Diaspora“ ist lange vor allem von der jüdischen Geschichtsschreibung für die Zeitspanne zwischen der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 70 n. Chr. bzw. der Vertreibung durch die Römer und der israelischen Staatsgründung im Jahr 1948 gebraucht worden. * Zu den Kreuzzügen vgl. S. 49 f. Literaturtipp: Norman Solomon, Judentum: Eine kurze Einführung, Stuttgart 1999 Internettipp: Zum Judentum siehe Code 32021-02 43Christliche und islamische Welt Nu r z u Pr üf zw ec ke n Ei ge nt um d es C .C .B uc hn er V er la gs | |
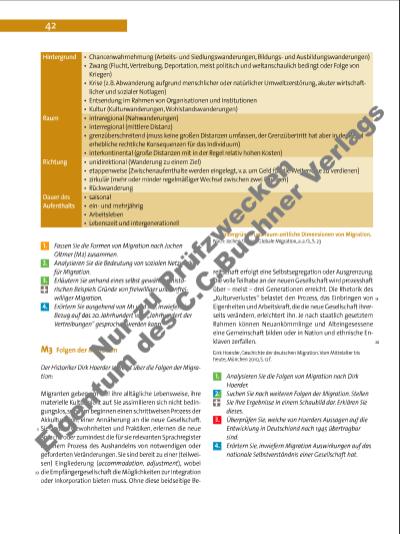 « |  » |
|
» Zur Flash-Version des Livebooks | |